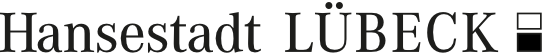Günter Grass: “Das Haus in der Stadt der sieben Türme”
Rede von Günter Grass anläßlich der Feierstunde zum 10. Todestag von Willy Brandt am 7. Oktober 2002, 18 Uhr, Theater Lübeck
“Nehmen wir Abstand. Unsere Gegenwart verlangt immer wieder Rückschau in die Abgründe der Geschichte. Im Februar 1937 reiste der emigrierte Journalist Herbert Frahm unter dem Decknamen Willy Brandt von Oslo aus über Paris nach Barcelona. Er reiste im Auftrag der norwegischen sozialistischen Arbeiterpartei, um die Lage im Spanischen Bürgerkrieg zu erkunden. 24 Jahre war er jung, doch die Flucht aus Deutschland und der unablässige Kampf gegen Faschismus und Nationalsozialismus hatten ihn mit Erfahrung gesättigt. Er war reifer, als sein Alter vermuten ließ. Grundsätzliche, seine Existenz prägende Entscheidungen waren ihm abgenötigt worden; hatte er doch gesehen, wie ein Volk, seines, in die Irre ging.
Nun aber erlebte er im Mai des Reisejahres, wie in Barcelona die Kommunisten, auf Befehl der sowjetisch dominierten Komintern, also aus dogmatischer Sicht, innerhalb des linken Lagers, mitten im Krieg einen Krieg gegen Anarchisten, Trotzkisten und weitere Abweichler führten. Säuberungen nannte man solche Aktionen. Wie der Schriftsteller George Orwell, dem er kurz vor dessen Verwundung begegnete, wurde auch Willy Brandt Zeuge des Massakers. Während Francos Falange Madrid bedrängte, wurden Tausende Republikaner von den Kommunisten liquidiert. Von diesem Verbrechen handelt George Orwells Buch "Mein Katalonien". Desgleichen gab Willy Brandt, kaum hatte er Spanien verlassen, in Paris seinen Genossen Bericht. Eine Erfahrung mehr war von Dauer.
Begegnung Brandts mit Heinrich Mann
In Paris jedoch zögerten viele, solch deprimierende Erkenntnisse zu akzeptieren. Im Kreis deutscher Emigranten begegnete der reisende Journalist dem Schriftsteller Heinrich Mann. Der sah den jungen Sozialisten, wenngleich politisch ahnungslos, mit Wohlwollen, zumal er von dessen Lübecker Herkunft erfuhr. Man kam ins Plaudern. Willy Brandt hat später von dieser Begegnung gerne und anekdotenhaft erzählt. Erinnerlich ist mir sein Lachen geblieben, sobald er zu des berühmten Schriftstellers Frage kam: "Sagen Sie, junger Mann, stehen denn immer noch die sieben Türme unserer gemeinsamen Heimatstadt?" - Heimweh mag dem Autor des "Untertan" diese Frage eingegeben haben. Sein Bild von Deutschland wankte. Vorausahnend sah er seines Vaterlandes Zerfall. Deshalb die Sorge um die vieltürmige Heimatstadt. Und deshalb heißt meine Rede, die zu halten ich heute die Ehre habe: "Das Haus in der Stadt der sieben Türme."
Es steht schon lange in der Königstraße, und es steht leer. Doch fortan soll es als "Willy Brandt-Haus" vom fortwirkenden politischen Nachlaß eines Staatsmannes von Weltrang belebt werden, der am 18. November 1913 in Lübeck geboren wurde, hier vaterlos aufwuchs, bereits als Schüler des Johanneums erste Zeitungsartikel schrieb und sich an seinem politischen Ziehvater, dem Sozialdemokraten Julius Leber, gerieben hat. Schon früh sprach aus ihm der kompromißlose Antifaschist. In der Nacht vom 1. zum 2. April 1933 mußte er seine Heimatstadt verlassen: von Travemünde aus brachte ihn ein Fischkutter zur dänischen Insel Falster. Aus Herbert Frahm wurde notgedrungen Willy Brandt. Doch in den Räumen des Hauses in der Königstraße kann sich fortan beweisen, daß er endlich heimgekehrt ist.
Ich begegnete Willy Brandt im Spätsommer 1961. Als Regierender Bürgermeister von Westberlin war er zugleich und zum ersten Mal Kanzlerkandidat der SPD, denn wenige Wochen nach dem Beginn des Mauerbaus quer durch die Stadt fanden Bundestagswahlen statt. Der vaterlose Emigrant und die Reise nach Barcelona boten als biographische Fakten noch Jahrzehnte später Willy Brandts politischen Gegnern Stoff und Manipuliermasse genug, um eine lange anhaltende, unter anderem von der Passauer Neuen Presse und Zeitungen des Springer-Konzerns gespeiste Diffamierungskampagne zu beginnen. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer und sein Eleve Franz Josef Strauß machten den Anfang, indem sie die uneheliche Herkunft und das Emigrantenschicksal ihres Gegners, den sie wie einen Feind niedermachen wollten, überaus wirkungsvoll für ihre Wahlkampfreden benutzten; zwei Christen besonderer Art.
Den Diffamierten, den in jenen Tagen die unmittelbaren Wirkungen des Mauerbaus viel Kraft kosteten, haben diese und weitere Verleumdungen anhaltend verletzt. Damals fiel es leicht, mit solch schäbigen Hinweisen und Verdächtigungen auf Stimmenfang zu gehen. Der versuchte Rufmord blieb ungeahndet. Die Öffentlichkeit reagierte lau. Allenfalls war in bezug auf die Verleumder von "Kavaliersdelikten" die Rede. Mich jedoch haben diese üblen Nachreden angestoßen und motiviert, als Schriftsteller meiner Bürgerpflicht zu folgen und laut und deutlich für den Verleumdeten einzutreten. Ich schraubte das Tintenfaß zu, verließ mein Stehpult, ergriff Partei.
Wenige Jahre später sahen wir uns als befreundet an. Dabei hätten wir verschiedener nicht sein können. Doch auch abgesehen von unserer auf Nähe und Distanz bestehenden Freundschaft verdanke ich Willy Brandt viel. Was mir im Literarischen leicht von der Hand ging und selbstverständlich war, nämlich aufs unscheinbare Detail zu achten und dennoch verwirrenden, widersprüchlichen, oft verdeckten Zusammenhängen zu folgen, lernte ich nun im Bereich der Politik zu erkennen und in öffentlichen Reden zu benennen. Er war mir tätiges Beispiel, nicht etwa kritiklos gesehenes Vorbild; von Hausaltären dieser Art hielten wir beide nicht viel.
Willy Brandt, der Pragmatiker, dem das Machbare wichtiger sein mußte als das Wünschenswerte, ließ dennoch nicht davon ab, ferne, utopische Ziele im Auge zu behalten. Ob als Bundeskanzler oder später, als Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission vor neue Aufgaben gestellt, stets war er von langem Atem, begriff dabei die Menschen in ihrer unmittelbaren Not und zeigte Wege auf, dieser Not - und sei es nur schrittweise - zu entkommen. Ihm waren begrenzte Siege und spürbare Niederlagen vertraut. Die Kehrseite des Fortschritts, die Melancholie, war ihm oft genug Tischgenosse. Auf seiner politischen Wegstrecke hat er viele Hürden erst im dritten Anlauf übersprungen. Oft habe ich mich fragen müssen, was trägt ihn, treibt ihn an zu solch wiederholter Mühe. Erst heute, zehn Jahre nach seinem Tod, beginnen wir zu begreifen, welch politische Weitsicht, wieviel vorweggenommene Zukunft ihn einerseits ausgezeichnet, andererseits vorausschauend mit Sorgen belastet hat, die uns gegenwärtig als die Welt erschütternde Krise eingeholt haben. Davon wird noch zu reden sein.
Brandts politische Arbeit muss fortgesetzt werden
So sehe ich denn das Haus in der Königstraße mehr als Wirkungs- denn als Gedenkstätte dergestalt: wer Willy Brandts politischer Arbeit gedenken möchte, wird sie, zehn Jahre nach seinem Tod, fortsetzen müssen, weil sie zukunftsweisend war und deshalb als nicht abgeschlossen anzusehen ist.
Der knappe Wahlsieg der rotgrünen Koalition verpflichtet beide Parteien, ihre mühevolle pragmatische Alltagsarbeit zu ergänzen, indem sie die von Willy Brandt entwickelten Konzepte zur Grundlage ihrer politischen Arbeit machen und von seiner visionären Kraft zehren. Es gilt, die deutsche Einheit zu vollenden, damit doch noch "zusammenwächst, was zusammengehört", und es gilt, die Erkenntnisse der von Willy Brandt geleiteten Nord-Süd-Kommission nach jahrelanger Ignoranz endlich wahrzunehmen und Entwicklungspolitik zugunsten der unter Verelendung und Ausbeutung leidenden Völker der Dritten Welt mit Vorrang als Beitrag zur Bekämpfung des Terrorismus zu begreifen.
In beiden Bereichen, beim schrittweisen Verringern der Ost-West-Spannung und in der Voraussicht auf den eskalierenden Nord-Süd-Konflikt, ging es Willy Brandt um die Erhaltung des Friedens durch mehr Gerechtigkeit und den Abbau dogmatisch verfestigter Gegensätze. Vielleicht ist es nützlich und erhellend, von weit weg und fern den deutschen Selbstbetrachtungen jetzt einen Blick auf jenen langwierigen Prozeß zu werfen, der mit dem vagen Begriff Entspannungspolitik und dem Namen Willy Brandt verbunden ist.
Vor vier Monaten besuchte ich Südkorea, eingeladen vom Goethe Institut und einer Universität in Seoul, die ein Symposium im Programm hatte, das auf die landeseigenen Probleme der anhaltenden Zweistaatlichkeit konzentriert war. Man hatte mich mit dem Hinweis auf meine kritischen Kommentare zum Prozeß der deutschen Einheit gebeten, eigene Erfahrungen vorzutragen. Man wolle, so hieß es höflich, lernen, die deutschen Fehler nicht zu wiederholen, wolle vielmehr die Einigung vor der Einheit anstreben.
Also reiste ich an, und mit mir machte sich gleichfalls, vermittelt durch das Goethe Institut in Seoul, der ostdeutsche Schriftsteller Uwe Kolbe auf die Reise.
Zwei Tage lang wechselten Vorträge und Debatten. Doch nicht nur von Korea-Süd und Korea-Nord und der doppelt bewachten Distanz zwischen beiden Landesteilen war die Rede. Überrascht nahmen wir zur Kenntnis, wie detailliert die vortragenden Politiker und Politologen mit der Deutschland-Politik der frühen 70er Jahre vertraut waren. Egon Bahrs These "Wandel durch Annäherung" blieb nicht nur Zitat, sondern wurde im Verhältnis zu den koreanischen Schwierigkeiten als Möglichkeit erkannt. Man wies mehrmals darauf hin, daß Willy Brandt, indem er so gut wie nie von der Vereinigung der beiden deutschen Staaten sprach, diese dennoch vorbereitet habe. Mehr noch: indem er jeweils das Nächstliegende tat - Familienzusammenführung, Reiseerleichterungen, Ausbau der Transitstrecken und dergleichen mehr -, doch niemals die Einvernahme des anderen Staates, so wie es später ruckzuck geschehen ist, zum Ziel seiner Bemühungen erhob und - die Gegenseite verschreckend - in den Vordergrund rückte, wurde Schritt nach Schritt möglich, was im Jahre 1990 leider im Eilverfahren und mit entsprechender Rücksichts-, weil Gedankenlosigkeit vollzogen wurde.
Vom gegenwärtigen Zustand der einerseits vom Glück begünstigten, andererseits durch westliche Dominanz beschädigten deutschen Einheit war in Korea nicht die Rede. Man steht dort am Anfang. Erste Rückschläge sind kaum verwunden. Seitdem der amerikanische Präsident Nordkorea als "Schurkenstaat" und Teil der "Achse des Bösen" bezeichnet, tun sich die Machthaber des abgeschotteten Staates schwerer, als es die ökonomische Not des Landes erlaubt. Stellvertretend suchte man in Seoul Zuspruch von außen, zog ferne Erfahrung zu Rate, hoffte auf Belebung der wegsuchenden Debatte; und inzwischen bewegt sich dort einiges, indem die so nützliche wie mühsame "Politik der kleinen Schritte" auf koreanische Gangweise versucht wird.
Und damit bin ich beim Willy Brandt-Haus in Lübeck. In seinen Räumen sollte das begonnene Gespräch fortgesetzt werden. Einzuladen wären nord- und südkoreanische Politiker, Ökonomen, Intellektuelle. Mit ostdeutscher Erfahrung könnte Wolfgang Thierse das Gespräch leiten. Wünschenswert wäre es, wenn gleichfalls Egon Bahr dabei wäre. Nur mit Respekt vor dem jeweils anderen ist Einigkeit zu verhandeln, notfalls zu erstreiten; denn die Mühsal der Einigung ist Voraussetzung für jene Einheit, die hierzulande nur auf dem Papier steht; allenfalls hat das Süd-, Ost- und Norddeutschland treffende Hochwasser erkennen lassen, was uns Deutschen gemeinsam ist.
Doch damit nicht genug. Dem Willy Brandt-Haus zu Lübeck wachsen weitere Aufgaben zu. Denn er, der Namensgeber des Hauses, dem das Steinewälzen nach dem Sisyphos-Prinzip lebenslange Disziplin gewesen ist, hat Beispiele weltweit fortwirkender Politik hinterlassen. Als er 1973 vor den Vereinten Nationen als erster deutscher Bundeskanzler sprach, war ihm auch das wachsende Elend in den Ländern der Dritten Welt Thema. Der Zufall wollte es, daß ich damals in New York war und Gelegenheit fand, im UNO-Gebäude seiner erstaunlichen Rede zuzuhören, die in dem Satz "Auch Hunger ist Krieg!" ihren Höhepunkt hatte. Ein Befund, der kurzerhand vom Beifall erschlagen wurde. Weiteres geschah nicht. Man ging zur Tagesordnung über, wie üblich, wenn direkt ausgesprochene Wahrheit den Konsens zu stören droht.
Doch er ist beim Thema geblieben. Nicht mehr als Bundeskanzler, wohl aber als Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission hat er die Zusammenhänge zwischen dem Wettrüsten in den ost-westlichen Militärbündnissen und der Armut in den Entwicklungsländern offengelegt. Die Weltbank gab dazu den Auftrag, die Vereinten Nationen zeichneten als Schirmherr. In einer Zeit, in der, selbst nach dem Abflauen des "Kalten Krieges", der Ost-West-Konflikt die Politik dominierte, hat Willy Brandt versucht, das Weltinteresse auf die verdrängte, doch tagtäglich vorhandene und auf jeden Fall unheilvoll zukunftsträchtige Konfliktlage im Süden zu lenken, auf den skandalösen Gegensatz zwischen Arm und Reich, auf Überfluß hier, Hunger dort, aber auch auf die wachsende Erbitterung in den armen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas über die Arroganz des reichen Nordens, der nicht bereit war und ist, auf einen Teil seines überschüssigen Reichtums und seiner ökonomischen Macht zu verzichten.
Vergeblich forderte Willy Brandt eine "neue Weltwirtschaftsordnung", die den Entwicklungsländern die Märkte des reichen Nordens öffnen sollte. Vergeblich mahnte er eine "Weltinnenpolitik" an, der die nationalen Interessen sich hätten unterordnen müssen. Vergeblich warnte er vor den Folgen wortreicher Untätigkeit. Niemand mochte auf seine Forderungen, Mahnungen, Warnungen hören. Selbst seine eigene Partei, deren Vorsitzender er war, stellte sich taub.
Rückbesinnung auf den Nord-Süd-Bericht
Als vor einem Jahr die Terroranschläge in New York und Washington besonders den kleineren, aber großmächtig reichen Teil der Welt erschreckten, hätte uns Rückbesinnung auf Willy Brandts Nord-Süd-Bericht, auch auf sein im Jahr 1985 erschienenes Buch "Der organisierte Wahnsinn - Wettrüsten und Welthunger" behilflich werden können, in den armen Ländern die Ursachen für Enttäuschung, Verbitterung, Zorn und Haß, der in schließlich vergeltenden Terror umschlägt, zu erkennen. Das Gegenteil war die Folge. Auf militärische Gewalt glaubte man setzen zu können, auch auf neue Gesetze, die mehr und mehr den eigenen demokratischen Freiheitsraum einschränken. Als hätte jemals Krieg ein Problem gelöst, den Hunger gemildert, der Verarmung abgeholfen, der Kindersterblichkeit entgegengewirkt, Wasser in Dürrezonen geleitet, den Handel - außer mit Waffen - gefördert.
Und dennoch steht neuer Krieg bevor. Weil Terror nach des Irrsinns Logik Gegenterror bedingt. Weil die einzig verbliebene Großmacht einen Feind benötigt. Weil der gegenwärtige Präsident der Vereinigten Staaten die Kritik der Verbündeten wie Majestätsbeleidigung wertet: "Wer nicht für uns ist, ist gegen uns!", und weil sich der "organisierte Wahnsinn" immer wieder aufs neue bestätigt. Oder wäre doch Abhilfe möglich? Kann sich das oft berufene "Umdenken" nicht nur auf Papier ereignen? Das Willy Brandt-Haus lädt dazu ein. Nach gewonnener Wahl sind die Sozialdemokraten zu aller erst dazu aufgerufen, gemeinsam mit den Grünen Versäumtes nachzuholen, den politischen Nachlaß des großen Vorsitzenden, all das, was der Nord-Süd-Bericht einklagt, endlich als ihre Aufgabe zu begreifen. Wer sich zu Recht der Teilnahme an dem drohenden Präventivkrieg verweigert, der muß die Alternative zur gegenwärtigen Kurzschlußpolitik als langfristiges Programm entwickeln und Schritt für Schritt solange realisieren, bis es den Menschen in der sogenannten Dritten Welt möglich ist, gleichberechtigt in einer einzigen Welt zu existieren, unbehindert Handel zu treiben, über die eigenen Rohstoffe zu verfügen, sich selbst zu bestimmen, also menschenwürdig zu leben, auf daß ihnen mit der Not und Verzweiflung schließlich der Haß vergeht. So, nur so werden Terror und Gegenterror ein Ende finden.
Das war Willy Brandts Überzeugung. Pragmatisch dem Alltag verpflichtet, ging er dennoch utopisch anmutende Ziele an. Was er uns hinterließ, verlangt danach, fortgesetzt zu werden. Das gilt im nationalen Bereich für die deutsche Einheit; das gilt weltweit für den eskalierenden Nord-Süd-Konflikt. Im Haus in der Königstraße sollten vordringlich diese beiden Aufgaben auf der Tagesordnung stehen. Willy Brandt bedarf keiner Gedenkstätte, wohl aber einer Werkstatt, die geräumig genug ist, seine immer noch tragfähigen Gedanken mit den Problemen unserer Tage zu belasten.
Ich erinnerte anfangs an die Pariser Begegnung zwischen dem jungen und dem alten Emigranten, zwischen Willy Brandt und Heinrich Mann. "Ja", bestätigte der eine des anderen Frage "Lübecks sieben Türme stehen noch." Doch sonst war im Jahr 1937 nichts Gutes oder Beruhigendes aus Deutschland zu berichten. Die Nationalsozialisten hatten ihr Macht- und Terrorsystem ausgebaut. Kein Widerstand regte sich. In Spanien erprobten Teile der deutschen Wehrmacht als "Legion Condor" ihre neuesten Waffen. Es sollte noch Jahre dauern, bis der junge Mann aus Lübeck heimkehren konnte. Und als er heimkehrte, sah man ihn und andere Emigranten mit Mißtrauen, schlimmer noch, mit Haß. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis dem Staatsmann von der Mehrheit im eigenen Land jene Anerkennung zukam, die ihm weltweit schon lange zuteil wurde. Selbst als ihm der Friedensnobelpreis verliehen wurde, verweigerte ihm im Bundestag die Opposition den Respekt. Seine Heimatstadt jedoch wird ihm und seinem zukunftsweisenden politischen Nachlaß ein Haus bereiten. Die Bürger Lübecks, der Stadt der sieben Türme, dürfen stolz sein auf Willy Brandt.
Mit einem Gedicht, das ich geschrieben habe, als der Freund und überragende Politiker von seinem Amt als Bundeskanzler zurücktrat, will ich schließen:
Federn blasen
Das war im Mai, als Willy zurücktrat.
Ich hatte mit Möwenfedern den sechsten tagsüber
mich gezeichnet: ältlich schon und gebraucht,
doch immer noch Federn blasend,
wie ich als Junge (zur Luftschiffzeit)
und auch zuvor
soweit ich mich denke (vorchristlich steinzeitlich)
Federn, drei vier zugleich,
den Flaum, Wünsche, das Glück
liegend laufend geblasen
und in Schwebe (ein Menschenalter) gehalten habe.
Willy auch. Sein bestaunt langer Atem.
Woher er ihn holte.
Seit dem Lübecker Pausenhof.
Meine Federn - einige waren seine - ermatten.
Zufällig liegen sie, wie gewöhnlich.
Draußen, ich weiß, bläht die Macht ihre Backen;
doch keine Feder,
kein Traum wird ihr tanzen.”
+++