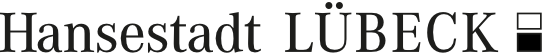Die “Herzenssache” Thomas Mann
Dankrede von Hanns-Josef Ortheil zur Verleihung des Thomas-Mann-Preises am Sonntag, 9. Juni 2002, im historischen Scharbausaal der Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck
“Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Juroren, meine Damen und Herren, liebe Kinder!
Ich sitze im Musikzimmer unseres Stuttgarter Garten-Hauses, als mich der Anruf an einem frühen Montagabend erreicht. Ich stehe auf und gehe mit dem Telefonhörer zur Glastür, während mein siebenjähriger Sohn Lukas noch die Klaviernoten für seine Klavierübungen sucht. Ich höre, daß mich jemand aus Lübeck zu sprechen wünscht, gerade jetzt, wo ich meinem Sohn beim Üben zuhören will. Ich höre die Stimme, und ich schaue, während ich antworte, etwas abwesend hinaus in den Garten, der kein Garten ist, sondern ein Stück weiter Natur, ein halber Bergrücken, hoch über dem Stuttgarter Talkessel.
Es ist bald Sechs, dann wird das Abendläuten beginnen, ein mich jeden Abend wieder überraschendes und oft rührendes Läuten mehrerer Kirchen, die nicht zugleich, sondern nach-, durch- und dann in einem merkwürdig geheimen Rhythmus miteinander läuten. Die Stimme in meinem Hörer erzählt mir von Lübeck, und während ich weiter sehr tranceartig hinaus in den Garten schaue, verbindet sich die Erzählung der Stimme mit dem erwarteten Läuten der Glocken. Ich stehe, sehe und höre, ´Glockenschall, Glockenschwall supra urbem...´, denkt es in mir, doch ich habe keinen Begriff davon, wer da spricht, wer das murmelt und flüstert.
"Du bist ganz weiß, Pappa", sagt mein Sohn Lukas, als ich den Telefonhörer weggelegt habe. "Ich werde den Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck bekommen", sage ich.
"Was ist der Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck?" fragt mein Sohn. "Es ist ein Literaturpreis", sage ich, "ein Preis, der nach dem Schriftsteller Thomas Mann benannt ist, der in Lübeck geboren wurde."
"Lebt Thomas Mann noch?" fragt mein Sohn. "Nein", sage ich, "er ist schon seit beinahe fünfzig Jahren tot." "War er ein großer Schriftsteller?" "Ja", sage ich, "das war er."
"Hast Du seine Bücher gelesen?" "Ja", sage ich, "einige kannte ich früher sogar in Ausschnitten auswendig." "Auswendig, richtig auswendig?" fragt mein Sohn.
"Ja", sage ich, "auswendig, hör mal zu: Glockenschall, Glockenschwall supra urbem, über der ganzen Stadt, in ihren von Klang überfüllten Lüften! Glocken, Glocken, sie schwingen und schaukeln, wogen und wiegen ausholend an ihren Balken, in ihren Stühlen, hundertstimmig, in babylonischem Durcheinander. Schwer und geschwind, brummend und bimmelnd, - da ist nicht Zeitmaß noch Einklang, sie reden auf einmal und alle einander ins Wort, ins Wort auch sich selber..."
"War das Thomas Mann?" fragt mein Sohn. "Ja", sage ich, "und wie findest Du es?"
"Großartig", sagt mein Sohn, "all diese Assonanzen und Alliterationen sind großartig: wogen und wiegen, brummend und bimmelnd..." "Ja", sage ich, "das ist Musik, hohe Satzkunst."
"Pappa", fragt mein Sohn, "machst Du eigentlich auch Musik und hohe Satzkunst?" "Nun ja", sage ich, "in Lübeck glauben Sie das zumindest ein bißchen."
"Ich glaub´s aber mehr als ein bißchen", erwidert mein Sohn und fügt, während er sich auf dem Klavierhocker dreht und seinem Instrument zuwendet, noch hinzu: "Pappa, Du bist immer noch weiß, geh mal ein wenig im Garten spazieren, ich übe schon mal etwas allein." "Ja, gut", sage ich, "dann gehe ich mal etwas im Garten spazieren, und Du übst Thomas Mann." "Aber Pappa", sagt mein Sohn, ganz gelassen, "Du mußt ihn üben, den Thomas Mann, ich übe jetzt Bach."
Als ich den Garten betrete, betrete ich ihn als Thomas-Mann-Preisträger der Hansestadt Lübeck. ´Wie betritt man einen Garten als Thomas-Mann-Preisträger?´, denke ich, doch dann beginnen wahrhaftig die Glocken im Talkessel zu läuten, es ist Sechs, Glockenschall, Glockenschwall..., an dröhnen die Klöppel und lassen nicht Zeit dem erregten Metall, daß es ausdröhne, da dröhnen sie pendelnd an am anderen Rande, ins eigene Gedröhne, also daß, wenn´s noch hallt "In te Domine speravi", so hallt es auch schon "Beati, quorum tecta sunt peccata", hinein aber klingelt es von kleineren Stätten, als rühre der Meßbub das Wandlungsglöcklein...
Ich schreite jetzt durch das Gras, ich passiere den Bauerngarten, doch in Wahrheit gehe ich am Mainzer Rheinufer spazieren, nicht weit von meinem Gymnasium. Am Mainzer Rheinufer befindet sich die Stadtbibliothek, vor einer halben Stunde habe ich mir auf Empfehlung eines Lehrers den "Tonio Kröger" ausgeliehen. Ich bin sechzehn Jahre alt, ich habe keine andere Lebens-Idee als die, ein Schriftsteller zu werden, und so beginne ich denn zu lesen, wie Tonio Kröger ein Schriftsteller wird: "Die Wintersonne stand nur als armer Schein, milchig und matt hinter Wolkenschichten über der engen Stadt. Naß und zugig war´s in den giebeligen Gassen, und manchmal fiel eine Art von weichem Hagel, nicht Eis, nicht Schnee. Die Schule war aus. Über den gepflasterten Hof und heraus aus der Gatterpforte strömten die Scharen der Befreiten, teilten sich und enteilten nach rechts und links. Große Schüler hielten mit Würde ihr Bücherpäckchen hoch gegen die linke Schulter gedrückt, indem sie mit dem rechten Arm wider den Wind dem Mittagessen entgegenruderten; kleines Volk setzte sich lustig in Trab, daß der Eisbrei umherspritzte und die Siebensachen der Wissenschaft in den Seehundsränzeln klapperten..."
Noch nie habe ich eine solche Sprache gehört. Ich empfinde sie als festlich, als verführerisch, zugleich aber auch als uneindeutig, als ernstes Wortspiel, wobei über dem Spiel der exakte, sich hochakustisch artikulierende Blick etwas Schwankendes, Impressives bekommt.
Als junger, angehender Schriftsteller von sechzehn Jahren hatte ich mir zuvor eine literarische Vater-Figur entworfen, deren Schreiben über ganz andere Tugenden verfügte. Am Beispiel von Ernest Hemingways Kurzgeschichten hatte ich bisher mein Schreiben geübt, ich hatte gelernt, dieses Schreiben zu korrigieren, es immer knapper, einfacher und lakonischer werden zu lassen: "Bilden Sie kurze Sätze. Machen Sie die Einleitungen kurz. Verwenden Sie ein kraftvolles Englisch. Seien Sie bejahend, nicht negativ. Vermeiden Sie den Gebrauch von Adjektiven, vor allem von solchen, die überspannt sind..." - das waren die der journalistischen Lehre entlehnten handwerklichen Regeln gewesen, an die Hemingway sich gehalten hatte. "Dann war das schlechte Wetter da" - so begann in charakteristischer Manier eine seiner Paris-Geschichten, auf deren Minimalismus ich mein Schreiben gebaut hatte.
Auch "Tonio Kröger" begann mit einer Schilderung schlechten Wetters, aber dort hieß es: "Naß und zugig war´s in den giebeligen Gassen, und manchmal fiel eine Art von weichem Hagel, nicht Eis, nicht Schnee." Das schlechte Wetter war in der Geschichte Hemingways einfach da, in der Thomas Manns war es jedoch "eine Art von weichem Hagel", genauer gesagt eine Konstellation von Wintersonne hinter Wolkenschichten, durchkreuzt von manchmal weichem Hagel einer besonderen Art. Nicht genug aber damit: Die Wintersonne stand nicht nur hinter Wolkenschichten, sie stand auch milchig und matt, wobei dieses Doppel mehrfach wiederkehrte, etwa im Doppel von "naß und zugig", "nicht Eis, nicht Schnee". Und dann die Adjektive! Mußte schon der Wolkenschein "arm" sein, so hätte man doch vielleicht darauf verzichten können, die Stadt "eng", den Hagel "weich" oder die Gassen "giebelig" zu dekorieren!
Im Gegensatz zur Sprache Hemingways kokettierte die Sprache Thomas Manns, sie drehte hochmütig und worttoll Pirouetten. Schüler trugen hier mit "Würde ihr Bücherpäckchen", die Scharen "teilten sich und enteilten", und wenn die Schule "aus" war, strömte man nicht nur aus der Schule heraus, sondern "heraus aus"...
Daß ich Thomas Mann aber dennoch verfiel, hatte nicht nur mit der Musikalität und Eleganz seiner Sprache, sondern auch mit der genial erfundenen Gestalt des zaudernden Tonio Kröger zu tun, dem gleichsam ideal-deutschen Porträt des Schriftstellers als junger Mann. Kaum ein Buch unserer Sprache ist in diesem Sinne ein so klassisches Pubertäts-Buch, voller lyrischer Stimmungen, aber auch philosophisch drapierter Reflexionen über Leben und Kunst, verschwommen und hochatmosphärisch auf der einen, kalkulierend und lehrhaft auf der anderen Seite. Eine solche Pubertäts-Vorgabe verliert sich nicht an Charaktere. Diese illustrieren vielmehr die schwebenden Spannungen des Buches, sie stehen still, nehmen an den erzählerischen Impulsen kaum teil, sind vielmehr Ausformungen des inneren Kompositionsgesetzes, das vorsieht, die Welt dem jungen Gemüt in einer einleuchtenden Polarität zu präsentieren: "Naß und zugig", "nicht Eis, nicht Schnee".
"Ist Dir nicht gut, Pappa?" weckt mich meine neunjährige Tochter Lotta aus meinen Gedanken. Ich gehe in unserem Stuttgarter Garten geradewegs auf sie zu, sie liegt lesend in einem Liegestuhl, doch ich habe sie bisher noch gar nicht bemerkt. "Ah", sage ich, "Du bist es, Du bist es also." "Pappa, Dir ist wirklich nicht gut. Du schwankst ja so seltsam", sagt meine Tochter. "Ich bin etwas überrascht", antworte ich, "ich habe gerade telefonisch erfahren, daß ich den Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck erhalten werde."
"Thomas Mann war ein Schriftsteller, nicht wahr?" fragt meine Tochter. "Richtig", sage ich, leicht verblüfft, "woher weißt Du das so genau?" "Aber Pappa, ich gehe doch in die dritte Klasse, da kennt man schon einige Schriftsteller", sagt meine Tochter. "Sehr gut", sage ich, "das finde ich sehr gut."
"Hatte Thomas Mann auch Kinder?" fragt meine Tochter. "Aber ja", sage ich, "er hatte sogar sechs Kinder." "Sechs Kinder!" seufzt meine Tochter, "da hatte er ja immer jemanden zum Spielen!" "Nun ja", sage ich, "sehr viel gespielt hat er, glaube ich, nicht mit ihnen."
"Aber er hat sicher etwas Schönes für sie geschrieben", sagt meine Tochter, "ein Kinderbuch und viele Geschichten." "Neinnein", sage ich, "dafür hatte er keine Zeit, er war vielleicht auch gar nicht so eine Art Vater, wie Du ihn Dir vorstellst, sondern eher so etwas wie ein Großvater."
"Dann war er einfach sehr alt", sagt meine Tochter. "Ja", sage ich, "so kann man es sagen, er war zeitlebens wohl eher ein älterer Herr, großväterlich, verstehst Du?" "Ja", sagt meine Tochter, "er hat gerne mit seinen Enkeln gespielt."
"Genau", sage ich, "mit den Enkeln, oder zumindest mit einem." "Und dann hat er Mittagsschläfchen gehalten wie Opapa", sagt meine Tochter. "Genau", sage ich, "Mittagsschläfchen wie Opapa." "Und später hat er einen Tee getrunken und etwas gelesen, auch wie Opapa", sagt meine Tochter. "Ich merke, Du kennst Thomas Mann schon sehr genau", sage ich, "Du kannst ihn Dir jedenfalls vorstellen."
"Kein Problem", sagt meine Tochter, "ich muß ja nur an Opapa denken, der fährt nach dem Lesen dann Fahrrad oder arbeitet lange im Garten oder spielt etwas Klavier oder zeigt uns seine Münzen." "So in etwa", sage ich, "nicht ganz genau so, aber in etwa." "Du schwankst noch immer, Pappa", sagt meine Tochter, "geh ruhig noch etwas durch den Garten spazieren, ich lese noch ein Stück weiter." "Ja, gut", sage ich, "dann lies Du nur weiter Thomas Mann, ich übe ihn noch im Garten." "Oweh, Pappa", ruft meine Tochter mir nach, "jetzt schwankst Du sogar in den Worten."
´Sie hat recht´, denke ich, ´der Anruf aus Lübeck hat mich etwas durcheinander gebracht. Ich gehe durch unseren Stuttgarter Garten, und noch im Gehen verwandelt sich alles in Mainz und dann wieder zurück, und jetzt, ja, jetzt ist sogar diese seltsamste aller Szenen da, eine Thomas Mann-Szene, aber wie hätte der sie erfunden?´ Ich bin siebzehn Jahre alt und nicht mehr nur der Leser des "Tonio Kröger", sondern ein Leser, der sich Thomas Mann schrittweise zu nähern versucht. Die schrittweise Annäherung dient einer biographischen Engführung, sie sucht nach versteckten Schlüsselerlebnissen, sie will das Biographische ausbeuten im Blick auf die eigene Erfahrung und das eigene Wachstum.
Also erfahre ich, daß Thomas Mann zwischen dem zwanzigsten und fünfundzwanzigsten Lebensjahr Monate, nein Jahre in Italien verbringt, er lebt in Rom, in Palestrina und noch weiter südlich, weil in ihm, wie er schreibt, ein großer Instinkt und Trieb stark sei, sich "so weit wie möglich aus deutschem Wesen, deutschen Begriffen, deutscher ´Kultur´ in den fernsten, fremdesten Süden auf- und davonzumachen".
Sofort leuchtet mir ein, daß dieses Sich-auf-und-Davonmachen die Bedingung für die Entstehung seines ersten großen Romans, für die Entstehung der "Buddenbrooks", ist. Abstand gewinnen, aus weiter Ferne über das Heimatliche-Enge schreiben: ich nehme mir vor, es genauso zu machen, "auf und davon", für Monate und Jahre nach Rom, sobald die lästige Schulzeit hinter mir liegt.
Und ich erfahre weiter, daß Thomas Mann sich nach seiner Rückkehr aus Italien zielstrebig und mit seltsamer Direktheit daran macht, um die junge Katja Pringsheim, Tochter eines vermögenden Universitätsprofessors, zu werben. Als Figur der Imma Spoelmann geht sie in seinen Roman "Königliche Hoheit" ein, diese "Imma ist ein bißchen zu schnippisch", hat Katja sich später mit der erfundenen Gestalt verglichen. Vor der ersten Begegnung soll Thomas Mann Katja Pringsheim lange nur aus der Ferne beobachtet haben, beim Fahren in der Trambahn, manchmal sogar mit einem Opernglas, hingerissen vor allem von ihren dunklen Augen. Monate sollen so vergangen sein, bis er sich bei Pringsheims vorstellen durfte, um einen Tee einzunehmen, mit Katja eine Radfahrt zu machen und schließlich mit einer Hartnäckigkeit um sie zu werben, die ihr keine andere Wahl ließ.
Die seltsamste aller Szenen..., jetzt erinnere ich sie, ich bin siebzehn Jahre alt, ich weiß von Rom und bis ins Detail über Katja Pringsheim Bescheid, als ich mich mit dem Orchester meines Mainzer Gymnasiums zu einem Probenaufenthalt im Rheingau befinde. Ich spiele das Cembalo, Vivaldi, Corelli, aber ich sehe nur ein fernes Paar brauner Augen, tagelang, und höre manchmal die etwas schnippische Stimme. Trambahnen existieren im Rheingau nicht, Operngläser sind nicht zur Hand. Ich bin so scheu, daß ich keinen Menschen nach den braunen Augen zu fragen wage, und erst recht wage ich es nicht, auch nur einen einzigen Schritt auf sie zuzumachen.
Am letzten Tag des Probenaufenthaltes müssen wir Musikanten von den Höhen unseres Rheingauquartiers zu Fuß hinab zur Bahnstation, gerade da beginnt es heftig zu regnen. Ich bin einer der wenigen, die einen Regenschirm mit sich führen, ich spanne ihn auf, als ich die braunen Augen an mir vorbeieilen sehe, trotzig und willens, unbeschirmt durch den Regen kilometerlang ins Tal zu schlendern, als schiene die Sonne.
Da, in diesem Moment, ereignet sich meine Thomas Mann-Szene, eine Ur-Szene, die mein ganzes Leben verändern wird. Ich bin ausgerüstet mit dem Raffinement seiner Dialoge, dem schwärmerischen Klang seiner Prosa, ich bin vorbereitet, und so haste ich denn mit meinem Regenschirm hinter den braunen Augen her, um sie dazu zu bewegen, sie beschirmen zu dürfen.
Es wird mir erlaubt, und so gehe ich denn, den Schirm hoch erhoben, denn die braunen Augen sind groß, beinahe ebenso groß wie ich selbst, zum ersten Mal an ihrer Seite ins Tal. Ich wage, sie nach ihrem Namen zu fragen, und sie erwidert, sie heiße Imma, nach der Imma Spoelmann in Thomas Manns "Königlicher Hoheit". Ihr Vater, erzählt sie weiter, habe den Roman während einer der acht Schwangerschaften ihrer Mutter gelesen und sogleich beschlossen, eine etwaige Tochter auf diesen Namen taufen zu lassen.
"Dann hast Du also sieben Geschwister", frage ich. "Ja", sagt sie, "und ich bin das siebente Kind." "Welchen Beruf hat Dein Vater", frage ich. "Er ist Physiker, er ist Universitätsprofessor", antwortet sie. "Seltsam", sage ich, "das erinnert ja wieder an Thomas Mann." "Wieso", fragt sie, "mein Vater ist Naturwissenschaftler." "Jaja", sage ich, "ich meinte was anderes." "An Thomas Mann erinnert eher, daß unsere Familie aus Lübeck stammt", sagt sie. "Aus Lübeck", sage ich tonlos.
"Ja", sagt sie, "stell Dir vor, meine Ururgroßmutter wurde in Lübeck geboren und war die Tochter eines Lübecker Kaufmanns und Senators." "Urur...", sage ich. "Ja", sagt sie, "sie war die Tochter von Heinrich Gustav Plitt, der zur Goethezeit in Lübeck lebte und neun Kinder hatte." "Neun...", sage ich. "Du glaubst mir wohl nicht", sagt sie, und ich antworte: "Natürlich glaube ich Dir, so erfüllen sich die Worte des Propheten." "Ich weiß nicht, was Du meinst", sagt sie. "Ich erklär es Dir einmal später", sage ich, "erzähl lieber noch etwas von Lübeck und Eurem Senator und Deiner Ururgroßmutter..."
"Sie war das sechste Kind", sagt sie, "die Familie wohnte in einem schönen Haus Große Petersgrube, die beiden Rauchschen Löwen, die jetzt vor dem Holstentor lagern, sollen einmal in diesem Haus gelegen haben." "Ich verstehe", sage ich, "Rauchsche Löwen, Holstentor, Lübeck...Wie alt bist Du eigentlich?"
"Fünfzehn", antwortet sie. "Soll das ein Scherz sein?" frage ich. "Ich bin fünfzehn", sage sie. "Entschuldige", sage ich, "ich habe Dich - aber wieso? - auf mindestens Zwanzig geschätzt."
Ich gehe in unserem Stuttgarter Gartengelände jetzt eine der alten Weinbergstäffele hinauf, die zu einem hoch gelegenen schmalen Weg führen, der, als reichte er geradewegs bis in den Süden, "Blauer Weg" genannt wird. Ich höre, daß meine Frau mit dem Wagen näher kommt, sie stellt ihn oben am Weg ab, und ich gehe zu ihr, um ihr zu berichten, daß ich der nächste Thomas- Mann-Preisträger der Hansestadt Lübeck sein werde.
"Ich gratuliere", sagt sie, "dann zeigen wir den Kindern Senator Plitts Haus und die Rauchschen Löwen vor dem Holstentor."
"Ja", sage ich und starre sie an. ´Thomas Mann´, denke ich, ´hat um Katja Pringsheim etwa ein Jahr geworben, aber schon nach einem halben Jahr gab es den ersten Besuch im Hause der Eltern. Ich habe beinahe zwei Jahre bis zum ersten Besuch im Hause der Eltern gebraucht, und geworben habe ich dann vierzehn Jahre, bis es soweit war mit der Heirat. Ich habe mich etwas verspätet, zweifellos, ich habe mir alle Kraft für das Spätwerk aufgehoben, vielleicht sollte ich diese Ungeheuerlichkeiten so verstehen.´
"Ist Dir nicht wohl?" fragt meine Frau. "Ach, Katja", antworte ich, "mir geht da gerade so allerhand durch den Kopf." "Moment mal", sagt meine Frau, "soll ich Dir ein Glas Wasser holen, Du bist kalkweiß." "Neinnein", sage ich, "ich gehe noch ein wenig spazieren. Kümmere Du Dich nur um die Kinder."
"Mir geht aber auch allerhand durch den Kopf", sagt meine Frau. "Und was?" frage ich. "Wie Du Dich nach Rom auf- und davongemacht hast und ich Dich später besucht habe, das war vor - warte mal - zweiunddreißig Jahren. Wir wohnten in dem kleinen Zimmer in der Via Bergamo 43, und auf Deinem Tisch lag ein dicker, nein, ein sehr dicker Stapel weißen Papiers. Du hast Deinen ersten Roman geschrieben, mit der Hand, Seite für Seite, und Du hast mir keine einzige Zeile daraus vorgelesen. Auf Deinem Arbeitstisch lag nichts anderes als dieser Stapel und die beiden Bände der Taschenbuchausgabe des "Zauberberg". Jeden Tag hast Du im "Zauberberg" gelesen, immer langsamer, als wolltest Du nicht ans Ende kommen, und als Du ans Ende gekommen warst, hast Du wieder von vorne begonnen. Daneben hast Du ein Tagebuch geführt und jeden Tag auch noch einige Briefe geschrieben, ich hatte bis dahin keine Ahnung, wieviel ein Mensch an einem einzigen Tag schreiben kann, ich hatte ein so elefantöses Ausdrucksbedürfnis noch nie erlebt."
"Stimmt", sage ich, "in gewissem Sinn ist so etwas unanständig." "Nun ja", sagt meine Frau, "immerhin ermöglicht es uns, eine sommerliche Reise nach Lübeck zu machen." "Entschuldige, Katja", sage ich, "nur noch eins, und sag mir bitte die Wahrheit: Läuten die Glocken noch?"
"Nein", sagt meine Frau, "nicht mehr, aber es stimmt, sie haben heute etwas länger geläutet als sonst, ich hatte es auch schon bemerkt...Ach ja, jetzt weiß ich, warum Du fragst. Sie läuten ja von den Höhen und aus der Tiefe, nicht wahr?" "Ja, genau", sage ich, "von den Höhen läutet es und aus der Tiefe, von den sieben erzheiligen Orten der Wallfahrt und allen Pfarrkirchen der sieben Sprengel zu seiten des zweimal gebogenen Tibers. Vom Aventin läutet´s, von den Heiligtümern des Palatin und von Sankt Johannes im Lateran, es läutet über dem Grabe dessen, der die Schlüssel führt, im Vatikanischen Hügel, von Santa Maria Maggiore, in Foro, in Domnica, in Cosmedin und in Trastevere, von Ara Celi, Sankt Paulus außer der Mauer, Sankt Peter in Banden und vom Haus zum Hochheiligen Kreuz in Jerusalem..."
"Jetzt gehen wir zusammen nach unten, ins Haus", sagt meine Frau. "Ja", sage ich, "gehn wir zusammen..."
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Juroren, meine Damen und Herren!
Die Hansestadt Lübeck hat zu ihrem zehnten Thomas Mann-Preisträger einen Schriftsteller gewählt, dessen Eltern durch den deutschen Faschismus und seine Folgen vor der Geburt dieses Autors vier Söhne verloren hatten. Aufgewachsen in einem stummen Raum auch nach dem Krieg nicht endenwollender Bedrohung und Angst, gebunden an eine Mutter, deren Verluste jedes menschliche Maß übertroffen hatten, hat er zur Sprache gefunden nicht in der Hoffnung, sie einmal leidlich zu beherrschen, sondern um mit ihrer Hilfe überhaupt am Leben zu bleiben.
Die Psalmen Davids - "Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, auf grünen Auen läßt er mich lagern; an Wasser mit Ruheplätzen führt er mich. Labsal spendet er mir. Er leitet mich auf rechter Bahn um seines Namens willen. Auch wenn ich wandern muß in finsterer Schlucht, ich fürchte doch kein Unheil; denn Du bist bei mir, Dein Hirtenstab und Stock, sie sind mein Trost" - diese Psalmen waren der Bittgesang seiner Kindheit, sein "In te Domine speravi", sein "Beati, quorum tecta sunt peccata".
Für einen solchen Schriftsteller wurde das sich allmählich entwickelnde und dann immer mehr überbordende Schreiben zur Bestätigung dieser Gewißheit, ja schließlich sogar zum Ausdruck eines Triumphes über den Tod.
Wenn die Juroren in ihrer Begründung zur Wahl des Preisträgers von einem "eigenständig-produktiven Werk" sprechen und weitergehend ausdrücklich die "überzeugende Verbindung von persönlichen Lebenserfahrungen mit den politisch-sozialen Veränderungen in Deutschland" würdigen, so würdigen sie damit in den Augen des Preisträgers nicht nur ein literarisches Werk, sondern mehr noch ein existentielles, ein Werk des Lebens.
Von ihm sehr nahen und aufgrund der familiären Geschichte eingebrannten Bildnissen hat der Preisträger in seinen ersten Romanen erzählt, nein, erzählen müssen. Heute, in dieser Feierstunde, hat er vom zweiten Teil seines Lebens erzählt, von der Rettung durch die Literatur und jene ihm sehr nahen Menschen, die durch ihr Dasein sein Schreiben ermöglichen, es verankern und zu einem Lebensraum gestalten, für den das Bild des Gartens und das des "Blauen Weges" nicht das einer Idylle, sondern einer Zukunftshoffnung ist.
In diesem Raum lebt für ihn Thomas Mann, nicht als ein Schriftsteller unter anderen, sondern als die prägende Schriftsteller-Gestalt seiner Jugend, als der Autor jener deutschen Romane, in die er sich am meisten verloren hat, als, verzeihen Sie den überspannten Begriff, eine Art "Herzenssache".
Von dieser "Herzenssache" wollte der preisgekrönte Schriftsteller heute morgen zu Ihnen sprechen, nicht im schweren und wohl oft auch schwermütigen Ton seiner ersten Bücher, nicht aus der Distanz oder gar theoretisierend, sondern im Ton jener leichten und manchmal übermütigen "Herzensheiterkeit", von der Mozarts A-Dur Violinsonate in jedem Takt handelt.
Ich danke der Stadt Lübeck für die hohe Auszeichnung, ich danke den Juroren für Ihre Wahl und deren Begründung, die mir mit jedem Wort bedeutet hat, welche Juroren es waren, die mir diesen Preis zugesprochen haben, ich danke Herrn Professor Koopmann für seine bewegende Laudatio, und ich danke Ihnen, meine Damen und Herren und liebe Kinder, für Ihre und Eure Geduld.”
+++