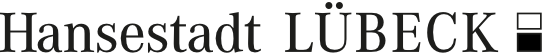Agenten und Schwerenöter, Deserteure und Flaneure
Laudatio von Prof. Dr. Helmut Koopmann auf den Thomas-Mann-Preisträger 2002, Hanns-Josef Ortheil
“Das neunzehnte Jahrhundert kannte eine Menschenart, die heute fast ausgestorben zu sein scheint: den Flaneur. Was ist ein Flaneur? Das ist kein Passant, der vorankommen, kein Durchgänger, der von irgend etwas weg und der irgendwohin will. Nein, der Flaneur hat es nicht eilig. Er ist ein Streuner, aber einer von Format. Der Passant hat nie Zeit, der Flaneur immer. Immer wieder hält er inne, registriert etwas und macht sich über das Gesehene seine Gedanken. Und er denkt häufig auch zurück: er sieht den Dingen, den Menschen, den Straßen ihre Geschichte an, er erfährt ihre Vergangenheit wie einen Film. Er hat zu allem, was er sieht und hört, etwas zu sagen, und bei alledem ist er kein Stadtneurotiker, sondern ein Stadtenthusiast.
Baudelaire war ein solcher Flaneur, die Straßen von Paris sein Jagdgebiet, durch das er hindurchschlenderte, um die Topographie seiner Stadt zu vermessen. “Im Flaneur begibt sich die Intelligenz auf den Markt”, hat Walter Benjamin einmal gemeint. Über den Flaneur können wir aber noch anderes lesen: “Der Flaneur gab ein Grundmuster für das Sehen, das Wahrnehmen und Entdecken des modernen Intellektuellen” . Das und noch mehr (Sie werden längst denken: wann kommt der Redner zur Sache?) steht in einem kleinen Aufsatz von Hanns-Josef Ortheil, überschrieben mit “Der lange Abschied vom Flaneur”; er ist 1986 verfaßt und gilt diesem Menschentyp, der an der Schwelle zur Moderne steht: sein betrachtender Blick eher noch einer älteren Zeit zugehörig, seine hellwache, kritische Intelligenz, der nichts verborgen bleibt, aber zugleich der Neuzeit, unserer Zeit zugetan. Der Flaneur hat etwas vom produktiven Müßiggang an sich, und wäre dem nicht so: er käme nicht zum Beobachten, geschweige denn zur Niederschrift des Beobachteten.
Ist dieser kleine, anregende, aufregende, aufregend gut zu lesende Aufsatz von Hanns-Josef Ortheil vielleicht so etwas wie ein geheimes Selbstbildnis? Natürlich - und doch wieder nicht. Natürlich - denn durch wieviel Städte ist nicht Hanns-Josef Ortheil gegangen, hat sie porträtiert, so daß der Leser das Gefühl hat, er lebte in diesen Städten, lebte darin intensiver, als wenn er selbst, sei er nun Flaneur oder nicht, durch sie hindurchgegangen sei. Hildesheim, wo er als Hochschullehrer wirkte, Rom, dessen geheimer Stadtführer er in Romanen und Aufsätzen ist und das er vermutlich besser kennt als mancher, der dort wohnt, Prag, Athen, Sofia, Berlin, Leipzig, Köln natürlich, wo er geboren ist, Wien, immer wieder Stuttgart mit seinem Gartenhaus, in dem er lebt: Stationen eines unruhigen Wanderlebens, auf dem ihn eines immer begleitet hat: Papier und Schreibgerät. Sein einziges Thema: die Städte, oder vielmehr: das Leben in ihnen, überhaupt das Beschreibenswerte an unserem Dasein. Aber Ortheil ist kein Registrator des Gegenwärtigen, die Geschichte blendet sich überall mit ein, gibt dem Beobachteten Patina und Farbigkeit, weist ihm den Rahmen zu, innerhalb dessen es zu betrachten ist. Der Blick auf Städte, Menschen, auf die ihnen gemeinsame Geschichte, auf die politischen Absonderlichkeiten unserer Zeit, auf die Kuriositäten und die Miserabilitäten, auf alles, was heute Öffentlichkeit heißt und zur Jedermannsware geworden ist: Ortheil hat einen kritischen Blick darauf. Aber oft auch einen verständnisvollen: er sieht die “Vielfalt des Lebendigen”, er ist den Menschen zugetan.
Hanns-Josef Ortheil flaniert nicht nur durch die Welt (es ist zumeist Europa, obwohl er auch außerhalb Europas bewandert ist), er flaniert auch durch die Zeit. Sein Buch Blauer Weg gibt sich äußerlich fast als Tagebuch, als Annual, beginnend mit dem Jahr 1989, endend 1995: ein Gang durch die Jahre, Miniaturbilder seiner Erfahrungen, seiner Beobachtungen. Ein Skizzenbuch, aber nicht oder jedenfalls über weite Strecken hin nicht Privatgeschichte, sondern darin eingeblendet Zeitgeschichte, Politik, Mauerfall und Porträts schreibender Zunftgenossen, und wenn er sich selbst darin auf vergleichbare Weise wie Wolfgang Hilbig oder Hans Joachim Schädlich, Monika Maron oder andere Stipendiats-Kollegen aus der Villa Massimo auf zwei oder drei Seiten abkonterfeit hätte: ich hätte leichtes Spiel, denn dann brauchte ich das nur abzulesen. Über die anderen: brillante Porträts, hier und da nicht ohne Schatten. Ortheil hat nichts beschönigt, aber auch nichts über die Maßen geschwärzt.
Das Buch ist zugleich ein Selbstporträt, doch über ihm könnte gut ein Titel stehen, den Thomas Mann für einen Vortrag gewählt hatte: “Meine Zeit”. Eingeblendet Szenen aus der früheren DDR, Schriftstellerverfolgung, die Wirklichkeit einer Diktatur. Wenn wir eine kurze Passage darüber lesen, wie es damals wirklich war, wissen wir alles. Gert Neumann etwa, keiner der großen Namen aus der DDR, ist einer der Verfolgten. Im Blauen Weg heißt es über ihn: “Wenn ich ihn besuchte, warteten draußen vor seiner Wohnung die Stasi-Mikroben. Sie hefteten sich an die Ritzen seiner Wohnungstür, sie zernagten das Postfach, sie legten Feuer im Treppenhaus, sie lungerten Tag und Nacht vor seinem Fenster, aufgedunsen und gelangweilt. Wenn wir das Haus verließen, setzten sie sich, ohne sich noch den Mühen der Tarnung oder des Verstecks zu unterziehen, in Bewegung. Sie blieben drei, vier Meter hinter uns, zu zweit oder zu dritt, wortlos, eine stinkende Spur von Verrat und Demütigung, die man hinter sich herzog. Setzten wir uns in ein Lokal, nahmen sie am Nebentisch Platz, so nah und aufdringlich, daß man sie hätte anspeien mögen. - Neumann mochte sie nicht ansprechen, er tat, als existierten sie nicht”. Bei einem Schriftstellertreffen traf er Neumann dann wieder, kurz nach dem Fall der Mauer, in Graz, wo man, so Ortheil nicht ohne ein wenig Bosheit, “noch immer so tut, als müßte man sich zur Avantgarde bekennen”. Neumann hatte nichts vergessen. Der Leser aber vergißt diese Geschichte auch nicht.
Ich kenne keine bessere, keine prägnantere Beschreibung des Spitzel- und Verfolgungswesen in der DDR. Christa Wolf hat seinerzeit lautstark ihre Observierungsgeschichte zu literarischem Protokoll gegeben, und wir wissen bis heute nicht, ob wir ihr die sehr viel behutsamere Beschattung durch die Stasi in ihren Ledermänteln glauben sollen oder nicht.
Es gibt aber nicht nur Düsteres zu berichten. Der Flaneur - er hat ein gewisses Verhältnis zum Leben und betrachtet es selten ohne Spott und Humor. Anlaß dazu gibt es eigentlich immerwährend. Darf ich eine kleine Kostprobe geben? Eine Groteske, der Besuch des Bundespräsidenten in der Villa Massimo- wo Ortheil (jetzt hätte ich fast gesagt: natürlich) auch Gast war. Das Tor des Villengeländes weit aufgerissen, “und sofort ist eine Motorradeskorte hineingeprescht, lauter Polizisten in Schwarz, gefolgt von einer heulenden Phalanx poliertester Limousinen, daß der weiße Kies vor dem Haupthaus ordentlich umgequirlt wurde, die großen Zypressen ihr Schweigen ablegten und hinter den Büschen lauter Wachmänneraugen auftauchten. Im letzten Fahrzeug, chauffiert von einer graublaue Handschule tragenden Chauffeurskapazität, saßen der Bundespräsident und seine Gattin, die es sich nicht hatten nehmen lassen, während ihres Epoche machenden Staatsbesuchs in Italien die Villa der deutschen Genies zu besuchen. - Die deutschen Genies warteten denn auch in einem der Ausstellungssäle, betont gelangweilt warteten sie, um schon im Vorfeld deutlich zu machen, daß sie den Staat richtig einzuschätzen wußten, so, wie es sich für junge Künstler gehört. Und so hatten denn sie sich auch nicht zurechtgemacht, nein, in ihren obligaten Sommerhemden und den sportiven Hellsommerhosen warteten sie auf den Bundespräsidenten, der zunächst noch anderes vorhatte. Orden wurden verliehen, Reden gehalten, Erfrischungen gebechert ... die jungen Genies warteten derweil.”
Ich muß es mir versagen, die ganze hübsche Szene vorzulesen. Nach einiger Zeit: “immer noch ein weiteres Preischen und noch ein kleines Verdienstkreuz”. Nach einigen Herren in den besten Anzügen kam er dann, in Präsidentenlaune, gut ausgeruht, “eigenfüßig, behende”, erfrischt, “daß sich niemand gewundert hätte, von dieser Entschiedenheit gleich mit fortgerissen zu werden, am besten bis zur Mittagstafel irgendwo in einem Staatsbesucherpalais”. Es folgt aus Staatsmund eine Ansprache, die ihresgleichen sucht, denn sie besteht eigentlich nur aus einem bundespräsidentialen ha und der Aufforderung, glücklich zu sein, angesichts eines Wohlbefindens auf Staatskosten, und dann werden die versammelten Genies, die wohl in einer Reihe so gut wie angetreten sind, präsidential adressiert. So kommt der Bundespräsident auch an den Flaneur. “Und wer ist dieser Große, Bedeutende, Ernste?' wollte er wissen. Das ist er Dichter O., flüsterte ihm jemand ins Ohr, worauf er sich zubewegte auf den längst Anvisierten und ihm nachdenklich die Hand drückte. Ah, das ist O., murmelte er, dieser O. also, der Dichter O.! Schon viel gehört von seinen Dichtungen, im kleinen wie im großen, das ist also der Dichter O.!” Nun, an Tiefe und Ernst dieser Ansprache ist nicht zu zweifeln. Die Szene der Begegnung zwischen Genie und Präsident schließt mit: “Der Dichter O. wollte auch gerade anheben, aus seinen Werken zu rezitieren, etwas Neues, eine Bundespräsidentenpassage, als schon wieder ein Lüftchen wehte, seitwärts, und die ganze Versammlung von den blendend aussehenden Männern mit den fixesten Manieren wie durch einen lange geplanten Raumangriff in eine andere Richtung gewendet wurde, wendab, worauf sich die gesamte Kolonne auf den Weg machte, über den kaum zur Ruhe gekommenen Kies”.
Nein, der Besuch ist noch nicht zu Ende, ein Bildhauerstudio wird besichtigt, reales Handwerk präsentiert sich, und dann - eine letzte kleine Passage -: “Hhm, hörte man den Bundespräsidenten sagen, und alle fragten sich: was hat er gesagt. Hhm, hat er gesagt, summte es auf dem ganzen Gelände, ein echt staatsmännisches Hhm! Und einige wollten schon ansetzen, sich dieses Hhm zu erläutern, doch dazu war nicht länger Zeit, denn seitwärts, wendab, da rumorte es schon in der Polizisteneskorte, und die großen Tore der Villa wedelten längst wieder im Sturm wie aufgeregte Hundeschwänze. - Weiter so, weiter so! ...so! rief der Bundespräsident den jungen Genies gerade noch zu, doch dann katapultierte ihn die allgemeine Bewegung hinüber zu den Eskorten, [...] und dann ging es, hui! ab und davon! [...] bis die große Zypressenstille sich meldete, dunkel wie täglich, und nur ein paar Strohhüte im letzten Windzug noch hasteten über den Kies”. Nun, das Verhältnis zwischen Literatur und Politik ist in Deutschland seit langem ein eher instabiles.
Diese Passage ist des Humoristen Thomas Manns würdig, und als ich das las, dachte ich: da ist jemand, der den zweiten Teil des Felix Krull schreiben könnte. Anders sicherlich, aber sicherlich nicht schlechter. Soviel zum Flaneur, dem Unbestechlichen, in politicis und auch sonst. Ein Parteigänger ist er nicht, aber ein unbestechlicher Kritiker, und wer etwas über deutsche Geschichte in diesen Jahren erfahren will, der lese den Blauen Weg. Er wird das Buch nicht so schnell wieder aus der Hand legen.
1993 war Hanns-Josef Ortheil übrigens auch (wieder einmal) in Rom und erinnert sich an einen Rom-Aufenthalt 1960. Wir lesen: “Hierher kam ich, kurz nach dem Abitur, mit einem kleinen Koffer und der hybriden Vorstellung, in Rom einen Roman schreiben zu müssen”. Das hatte derjenige, in dessen Namen hier der Preis verliehen wird, auch vorgehabt, hier waren die Buddenbrooks begonnen worden, Ende Oktober 1897. Rom, Via Torre Argentina 34, drei Stiegen hoch. Hanns-Josef Ortheils Reiselektüre? Er schreibt: “Den Zauberberg hatte ich dabei, ich wollte ihn ein zweites Mal lesen, ganz langsam, in kleinen Portionen, die genau für ein halbes Jahr reichen sollten, bis zu meiner Rückkehr nach Deutschland”. Thomas Mann hätte sich befriedigt gezeigt. Denn wir wissen ja, daß er vom Zauberberg gesagt hat, man müsse ihn zweimal lesen. Es heißt: “In einem winzigen Zimmer der Via Bergamo 43 schrieb ich Seite für Seite, und als das halbe Jahr vergangen war, setzte ich, um dem jugendlichen Pathos meiner Anstrengung besonderen Nachdruck zu verleihen, ein Finis unter die bildschön beschriebenen Bögen”. So schnell war Thomas Mann damals nicht: er hat immerhin drei Jahre für sein Buch gebraucht.
Soviel, noch einmal, zum Flaneur. Was aber zu den Agenten und Schwerenötern, was zu den Deserteuren? Nun, Schwerenöter und Agenten sind Titel von Romanen Hanns-Josef Ortheils. Über Deserteure, “Deserteure in bleierner Zeit”, hatte er schon 1979 einen kleinen Essay geschrieben - das Jahr, in dem sein Roman Fermer als Debüt erschien. Die bleierne Zeit - das war die Zeit der 70er Jahre, die Zeit der Terroristen in Deutschland, aber auch die Zeit der Angepaßten, die ihre “Ämter und Stellungen” gefunden, sich selbst aber dabei gleichsam verloren hatten. Für die um 1950 Geborenen eine Zeit ebenso unbestimmter wie nachdrücklicher Übergänge, sie lebten wie im Wartesaal. Genauer: sie standen am Rande, waren Einzelgänger in einer Gesellschaft, die weder sie wollte noch die sie wollten, und so kamen sie sich vor wie Deserteure “in einem ungeliebten Land, das wir oft tagelang durchzogen, um es uns erträglich zu machen”. Das war die Generation derer, die in einem anderen Sinne “draußen vor der Tür” waren, und sie mochten durch diese Tür nicht hindurchgehen. Eine gereizte junge Generation, aber keine verbitterte: sie wollten anders sein. In dieser Zeit reifte bei Ortheil wohl der Entschluß, darüber Romane zu schreiben. Von Deserteuren ist es nicht weit zu Agenten: 1983 war Hecke erschienen, 1987 Schwerenöter: alles Zeitromane.
Wir greifen Agenten heraus, diese prägnante soziale Studie, in der die sozialen Kräfte der damaligen Jahre und die subkulturellen Veränderungen der neuen Existenzen sichtbar werden, die Aufsteiger, die Selbstdarsteller. Es ist die “innere Geschichte der im Westen aufgewachsenen Nachkriegsgenerationen”, die hier erzählt wird, und Ortheil, der nicht nach Kalkutta gegangen ist, um große Romane über Deutschland schreiben zu können, sondern der sein Kalkutta in Deutschland suchen mußte, er fand es. Eine neue Subjektivität hatte sich damals breitgemacht, es gab Ego-Trips, Reisen nach Innen. Auch das war eine Jugend in Deutschland. Agenten waren die, die ihren Freunden nicht mehr trauten, die sich mit Geheimdienstmanieren durchs Leben mogelten, die nur die eigenen Verhältnisse im Kopf hatten - eigentlich eine verlorene Generation. “Es war ein matter Sommer, lauter lausige Tage”, so beginnt der Roman, und so endet er auch. Es sind die lausigen Tage eines lausigen Lebens, allem Geglitzer in den Szene-Lokalen zum Trotz. Ein betäubtes Dasein - “wir rechnen uns nirgends dazu”, heißt es im Roman. Da wird die ganze Pracht der neuen Gründerzeit der 80er Jahre dekuvriert, die Mentalität des “Mithaltens”. So lungern diese Außenseiter in den Tag hinein, sind lebensmüde, bevor das Leben für sie eigentlich angefangen hat, und in dieser Welt machen sich nicht nur Krankheiten breit, da versagen auch andere: die Väter.
Ein zentrales Thema für Hanns-Josef Ortheil. Auch der Abschied von den Kriegsteilnehmern, 1992, handelt davon: der martialische Titel hat die Vätergeneration im Visier. Väterliteratur hat es um 1980 herum in beträchtlichem Ausmaß gegeben, aber Ortheil hat das Phänomen der Väterliteratur mit diesem Roman neu definiert. An die Stelle der Auseinandersetzung mit den Vätern ist die Flucht vor dem Vater getreten, doch gleichzeitig sucht der Sohn dem Vater gerecht zu werden. Das ist nicht “nachgetragene Liebe” wie bei Peter Härtling, um nur ein Beispiel aus der älteren Väterliteratur zu nennen, das ist der endgültige Abschied von jener Vätergeneration, die untergründig die Literatur der Bundesrepublik so nachhaltig beschäftigt hat. Mit der neuen Völkerwanderung in den Westen 1989 ist, so Ortheil, die Nachkriegszeit definitiv an ein Ende gekommen.
Mit Ortheil hat eine Renaissance des Zeitromans begonnen. Diese Textsorte ist nicht ohne Tücken. “Der Autor des Zeitromans setzt sich Angriffen und Schmähungen aus”, so Ortheil, “er geht das hohe Risiko ein, jetzt, ohne distanzierten Blick zu sagen, ‚was der Fall ist'“. Ja, was ist der Fall? Er hätte auch sagen können: was jetzt wirklich geschieht. Nicht an der Tagesoberfläche, sondern als Bewegung in der Zeit. “Die Geschichte bedarf nicht der Illustration (das erledigen die visuellen Medien), sondern der benennenden Deutung und Durchdringung”, hat Ortheil auch einmal gesagt. Darin hat er, darin “Zeit-Schriftsteller” wie Ludwig Börne, mächtige Ahnherren, und der mächtigste von ihnen ist Thomas Mann. In einem Punkt folgt Ortheil dem großen Vorbild Thomas Manns genau: auch er hat die Zeit verräumlicht, die vierte Dimension in Topographie übersetzt. Wie im Zauberberg gibt es in Abschied von den Kriegsteilnehmern eine Ost-West-Achse, nicht gerade zwischen westlicher Form und östlicher Unform, aber doch voller symbolischer Eindringlichkeit: der Sohn trägt den Vater und seine vier toten Brüder am Ende des Romans nach Osten, ein neuer Aeneas, dem Strom der Flüchtlinge nach Westen entgegen, “um sie hier, in der fernen Weite, zu begraben für immer ...”. Das ist eine mythisch grundierte Vision, aber bei Ortheil haben die Visionen ihre eigene Realität.
Wollte man die Geschichte der 70er und 80er Jahre beschreiben, hier, bei Ortheil, findet man sie. “Nicht wie es gewesen ist, soll der Zeitroan dokumentieren, sondern was das Geschehene für Menschen in einer konkreten Situation, an einem konkreten Ort bedeutet”, schrieb Ortheil 1990. “Deutung und Wertung” also im Zeitroman - aber auch “Kritik, Gesellschaftskritik” als das eine Ziel. Der Titel der 1980 von Ortheil veröffentlichten Dissertation wirkt heute fast wie eine Vorwegnahme dessen, was der Romancier dann geleistet hat; er lautet: Der poetische Widerstand im Roman - eine Formel, die cum grano salis für alle seine Zeitromane gelten kann. Die Doktorarbeit beschäftigt sich mit dem Zusammenhang “zwischen ‚Umbruchszeit' und Roman”, sein Gebiet war damals der Roman des 17. und des 18. Jahrhunderts. Aber Ortheil zeigt in seinen eigenen Romanen, daß auch die 70er und 80er Jahre Umbruchszeiten waren, und die Geschichte dieser Umbruchszeiten hat er geschrieben.
“Wo komm ich her? Wer bin ich? Wohin wandr' ich?” fragte Varus in Kleists Hermannsschlacht. Eine Antwort auf diese Fragen, die vielleicht unser aller Fragen sind, gibt ein altes jiddisches Sprichwort, und das lautet: Wenn wir nie vergessen, wo wir herkommen, werden wir immer wissen, wo wir hin müssen. Der Zeitroman, so Ortheil, hat neben der Kritik noch eine andere Aufgabe: “den Menschen eine Zukunft zu eröffnen, gewissermaßen ‚Menschenfreundlichkeit' herzustellen”. Das Geschehene, sagt Kafka einmal, “kann nicht rückgängig gemacht, sondern nur getrübt werden”. Aber es kann auch aufgehellt werden, und eben dieses geschieht in den Romanen Ortheils.
Woher kommt die Sicherheit in seiner Porträtkunst, wenn es um die Zeit geht? “Einen Zeitroman zu lesen”, so hat Ortheil auch gesagt, “heißt [...] immer: die eigene Lebenserfahrung auf direkte Weise mit der der Romanfiguren abzustimmen”. Aber das gilt ebenso für das Schreiben von Zeitromanen, nicht nur für das Lesen: Ortheils Romane enthalten erlebte Geschichte. Wir kennen das. Kein großer Erzähler der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, bei dem nicht das autobiographische Substrat und Fundament des Erzählens ist: das gilt für alle Großen wie für Dutzende von minor poets. Geschichte: das sind vor allem Erfahrungen der Welt, aus der wir herkommen. Ortheil hat sich nie gescheut, auch über sich zu berichten - das schönste Zeugnis ist sein Buch Das Element des Elephanten, 1994 erschienen, seine Lebensgeschichte, aber mehr noch die Geschichte seines Schreibens, die Stationen seiner Schreibbesessenheit - so muß man das wohl nennen. Ortheil braucht zum Schreiben keine heroische Landschaftsszenerie oder den spektakulären Anblick des Meeres, nicht “Räume mit weiter, malerischer Aussicht” oder die “freie und angeblich stimulierende Natur” mit ihrer “Vielfalt des Gesehehen”: romantisierende Vorstellungen von Schreibunkundigen, die Wirklichkeit sieht anders aus.
“Der Raum des Schreibens”, so kann man bei Ortheil lesen, “ist für mich ein ganz anderer, es ist ein abgeschlossener, intimer, ja dunkler Raum. Am besten gelingt das Schreiben überhaupt in ganz winzigen, engen und unauffälligen Räumen. [...] Die idealen Schreibräume sind daher Höhlen oder kleine, von anderen Räumen abgesonderte Zimmer, fensterlos oder mit Fenstern, durch die man immer denselben, unveränderlichen und monotonen Ausschnitt der Welt gewahr wird”. Also eine fast mönchsklausenähnliche Anlage, als Bücher allenfalls Stimulantia, Lexika, Wörterbücher und Nachschlagewerke zugelassen: so sieht die Schreibwerkstatt Ortheils aus. Aber er ist alles andere als ein Elfenbeinturmbewohner. Dazu ist viel zuviel Welt in ihm, Vergangenheit hinter ihm. Seine eigene Geschichte - sie ist das Fundament nicht nur für Zeiterfahrungen, sondern auch für Schreiberfahrungen. Ortheil hat seine Erinnerungen nie unterdrückt, die Geschichte seines eigenen Lebens ist in fast alle seine Romane eingegangen. Aber nur so sind Zeitromane heute zu schreiben. Präzise vermessen kann man nur die eigene Welt, aber wo das geschieht, wird auch die Welt der anderen beschreibbar.
“Autobiographie aber ist alles”, hat Thomas Mann einmal gesagt, und auch, aus der Selbstsicherheit seiner Repräsentantenrolle: “In mir lebt der Glaube, daß ich nur von mir zu erzählen brauche, um auch der Zeit, der Allgemeinheit die Zunge zu lösen, und ohne diesen Glaubens könnte ich mich der Mühen des Produzierens entschlagen”. Für seine Zeitromane könnte auch Hanns-Josef Ortheil das in Anspruch nehmen. Wir müssen freilich hinzusetzen: die narzistische Komponente fehlt ihm. Der Flaneur läßt seinen beobachtenden Blick nicht so sehr auf sich selbst ruhen, sondern auf der Zeit, die Gestalten, die sie bevölkern. Und das nicht ohne liebevolle Ironie, nicht ohne humoristische Nachsicht. “Ich glaube, daß es nicht schwer sein wird, in meinem Schreibwerk das humoristische Element nachzuweisen”, hat Thomas Mann einmal gesagt. Das könnte Hanns-Josef Ortheil auch für sein Werk beanspruchen, mit Recht.
Thomas Mann hat sich einmal sogar in hexametrischem Humor versucht, in jener Idylle “Gesang vom Kindchen”. Entstanden sei die kleine Idylle, so Thomas Mann, aus einem tiefen Bedürfnis nach “Heiterkeit und herzlicher Menschlichkeit”. Auch Hanns-Josef Ortheil hat seinen “Gesang vom Kindchen” geschrieben, oder richtiger: Lo und Lu, den “Roman eines Vaters”. Das Buch kann es, was Heiterkeit und was das Lebensweltliche angeht, durchaus mit Thomas Manns Idylle aufnehmen, es ist der Roman seiner Kinder, aber wir könnten auch sagen: Das sind weltgeschichtliche Betrachtungen, die Literatur eingeschlossen und die Kunst auch. Lesen Sie nach, wie Werke von Josef Beuys aus Kinder- und Vaterperspektive aussehen. Besuchen Sie mit Kinderaugen die englische Queen, die beim Winken “ihre Hand wie einen Scheibenwischer bewegt, als wollte sie die Bilder der Menschen am Wegrand aus ihrem Blickfeld entfernen”. Und man lese die wunderbare Parodie auf die schon so parodistische Szene, in der Krull vor den Militärärzten steht - hier ist es Lo, die für die Schule gemustert werden soll. Ich würde sie Ihnen am liebsten vorlesen.
Manchmal Spott, Spott auch über das Literarische. Etwa: “Das Schlimme ist nur, daß Elan, Enthusiasmus und das erwünschte Glück nicht für das Literarische taugen. Seit Jahrhunderten haben sich die besten Schriftsteller vielmehr Freude und Glück aus guten Gründen strengstens verboten, jeder Leser weiß schließlich inzwischen, wie unglücklich es in der Literatur zugeht, die beste Literatur ist vor allem aus Unglück gemacht, steht überall, und wenn es das Unglück nicht gäbe, müßte man es erfinden, so langweilig wäre sonst alles, vor allem aber die Literatur”. Ortheil tritt den Gegenbeweis auf der Stelle an: sein Roman eines Vaters ist auch ein Buch über Glück. Das ist mehr als Kinder-Glück. Wir lesen: “es gibt die Müdigkeit und den Verdruß. Aber all das markiert nicht die Weite des Lebens, die Weite des Lebens wird ausschließlich markiert von der Freude und dem alltäglichen Glück”. Es sind weise Sätze. Eigentlich ist Hanns-Josef Ortheil viel zu jung für solche Weisheit, die am Ende eines Lebens stehen mag. Aber recht hat er trotzdem.
Ich fürchte schon seit einer Weile, daß Hanns-Josef Ortheil gleich aufstehen und sagen wird: “Vielen Dank für diese kurze, alles Wesentliche verschweigende Einführung”. Damit er das nicht tut, abschließend noch einige Worte über eine andere Welt im Werk Hanns-Josef Ortheils. Im Vaterroman steht: “Früher habe ich Gegenwarts-Romane geschrieben [...] Ich schlug die Zeitung auf, und schon strömten die Aromen der Gegenwart mir entgegen, [...] jetzt aber ist das alles dahin, ich spüre nichts mehr, ja ich weiß nicht einmal mehr, worüber man sich so unterhält”. Da sind noch die Italien-Romane, in vergangenen Zeiten spielend: Faustinas Küsse, 1998, Im Licht der Lagune, 1999 und Die Nacht des Don Juan, 2000. Nur von letzterem soll hier noch kurz die Rede sein. 1982 hatte Ortheil schon über Mozart im Innern seiner Sprachen geschrieben, ein Buch über die vielen Sprachen in Mozarts Briefen, eine Biographie an Hand seiner Briefe, die auf ihre Weise Musik sind. Aber dann Die Nacht des Don Juan: Casanova mischt sich in Prag ein in das Werk da Pontes, er komplimentiert den Librettisten hinaus aus der Stadt, aus der Musik, aus dem Leben in Prag. Mozart hat noch die Ouvertüre zu schreiben, und es gelingt ihm in dieser und trotz dieser Welt von Intrigen, Verwechslungen, Verkleidungen, Nachstellungen, Liebesaffären. Wirklichkeit und Illusion vermischen sich, und Casanova, der sich auch in Mozarts Prager Dasein hineingedrängt hatte, erkennt plötzlich, daß seine eigene Lebensgeschichte untrennbar in die Geschichte des Don Juan eingeflochten ist - und während Mozart seine Opernkomposition beendet, beginnt Casanova mit dem Schreiben seiner Memoiren. Vorher schon haben Szenen der Oper Stunden in Prag wiederholt, “so als wäre die Oper ein Abbild des Lebens oder das Leben ein Abbild der Oper, es war kaum noch zu verstehen”. Ja, “die fremde, erregende Welt, die “Zauberwelt der Bühne und der Maskeraden [...] Welt der heimlichen Entdeckungen und der bösen Träume”, das verschwimmt ineinander. Aber auch der Tod ist gegenwärtig, denn schließlich fährt Don Juan ja zur Hölle - “Wie ein gewaltiger drohender Donner dröhnte die Stimme des Steinernen Gastes jetzt aus der Tiefe - dann schlug ein Flammenmeer hinauf bis zum Himmel, das Ende war gekommen, ja, die Flammen machten sich über den Wüstling her, und die Glut zog ihn hinab”. “Das Ende kommt, es kommt das Ende”, so lesen wir auch im Doktor Faustus, und die “Höllenfahrt” dort zitiert jene andere Höllenfahrt, in der es mit Deutschland in den “Höllenschlund” hinabging. “Von diesem Don Giovanni wird man sich noch in zweihundert Jahren erzählen”, meint Casanova. Aber einige Dezennien doch auch wohl von Ortheils Roman über die Nacht des Don Juan. Was nicht das schlechteste ist: man kann diesen Roman auch als Kriminalroman lesen oder als einen außerordentlich gut komponierten Theaterroman - Szene auf Szene, genau fünfzig. Es ist in etwa der Umfang des Doktor Faustus, mit der Nachschrift sind es dort 48 Kapitel. Um die Spitzfindigkeit auf die Spitze zu treiben: Das Kapitel XXXIV des Doktor Faustus besteht eigentlich aus drei Kapiteln, und nimmt man die Nachschrift wieder aus der Rechnung heraus, sind es im Doktor Faustus ebenfalls genau fünfzig Kapitel. In der Mitte, Kapitel XXV, das Teufelsgespräch, die wechselnden Masken des Bösen. Übrigens liest Leverkühn, bevor der Teufel kommt, “Kierkegard über Mozarts Don Juan”. Bei Ortheil im fünfundzwanzigsten Kapitel: ein Spiel mit Larven, Masken, Verkleidungen. Mundus vult decipi. Doch wir wollen das Spiel nicht zu weit treiben - es mag allenfalls Zutat sein. Mit solchen Rechnereien beschäftigen sich aber manchmal die Germanisten und nennen das Geisteswissenschaft. Oder auch Zahlensymbolik - Arbeiten zum Doktor Faustus darüber sind nicht gerade selten. Kein Wunder, daß diese Gelehrtenspezies der Scharlatanerie verdächtigt wird.
Das Ende sei auch hier gekommen. Es wäre noch soviel anzumerken, etwa über das feine und dichte Netz an Weltliteratur, das sich hinter den Romanen und den Essays zu erkennen gibt - das hier Gesagte kommt an das Gelesene und zu Lesende ohnehin nicht heran. In seinem schönen Essay über Proust, “Suchbewegungen der Lesekultur” überschrieben, finden wir: “Das Lesen entwickelt eine besondere Form der Zeit, eine Dauer ‚außerhalb' der alltäglichen Zeit, Dies ist der Grund dafür, daß sich der Leser nicht von seinem Buch trennen möchte. Er möchte es zu Ende lesen, was nichts anderes heißt als: er möchte möglichst lange in diesem Zustand ‚außerhalb' der Zeit verweilen”. So wird es wohl jedem Leser gehen, der sich in die Welt des Erzählers Hanns-Josef Ortheil begibt. Es wird ihm, so hoffe ich, das alltägliche Hören und Sehen vergehen, wenn die Romane ihn einsaugen in ihr Reich. Wie hieß es doch am Ende der Buddenbrooks? “Es ist so”. +++
Prof. Dr. Helmut Koopmann, Jurymitglied, ist Literaturwissenschaftler an der Universität Augsburg