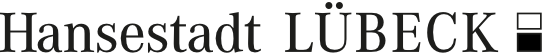Mit einer Rückschau auf zwölf Jahre an der Spitze der Hansestadt Lübeck hat sich Bürgermeister Michael Bouteiller, 56 (SPD), am 28. April im Rathaus vor einer großen Zahl von Gästen aus dem In- und Ausland offiziell verabschiedet.
Die Rede des bis 30. April 2000 amtierenden, 227. Bürgermeisters der Hansestadt Lübeck hat folgenden Wortlaut:
Anrede. „Vor Ihnen steht ein freier Mann. Nein, gemeint ist nicht der vom Amt Befreite, sondern der freie Bürger, wie er in Lübeck eine alte Geschichte hat. Als dieser kam ich 1988 nach Lübeck, der bin ich auch noch heute. Und als dieser freie Bürger war ich über Jahre ganz offenbar für einige Menschen dieser Stadt ein Problem, für andere eine große Freude. C' est la vie.
Schon am Beginn meiner Amtszeit formulierte ich mein wichtigstes Ziel: Ich wollte die Stadtverwaltung vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist in der Zwischenzeit fast unbemerkt geschehen. Ich bin froh, meinen Anteil daran zu haben, denn auch dieser Prozeß hat sehr viel mit freien Bürgern zu tun. Ein Mitarbeiter hat mir neulich statt eines persönlichen Abschieds geschrieben, ich zitiere: .."möchte ich vorsorglich schon einmal adieu sagen und hinzufügen, daß ich mich in Deiner Amtszeit in Lübeck als Mitglied dieser Verwaltung sicher und geborgen gefühlt habe. Ich habe Dir stets hoch angerechnet, daß Du den gelegentlichen „Störer" einigermaßen gewähren ließest und ihm nichts nachgetragen hast." Zitat Ende. Das ist ein guter Beweis für die von mir gemeinte Veränderung.
Ich habe mich bemüht, andere ohne Ansehen der Person so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden wollte. Das ist mir nur dann schwer gefallen, wenn ich mit mir selbst nicht im Reinen war. Um durch solches Ungemach verursachte Mißdeutungen in meiner Umgebung vermeiden, erzählte ich oftmals vier pädagogische Geschichten:
Die Geschichte von der Chefsekretärin gemeint ist nicht Frau Klagemann, die, wenn sie den unwirschen Gesichtsausdruck ihres Chefs wahrnimmt, mit dem er morgens das Büro betritt, sofort fragt, was sie denn falsch gemacht habe, statt zu fragen, was denn dem Chef über die Leber gelaufen sei.
Oder die Geschichte des Ehepaars, wo der Mann morgens früher aufwacht. Einmal bewundert er den Liebreiz seiner schlafenden Angetrauten. Den anderen Morgen ist er über den fehlenden Liebreiz enttäuscht. Nicht die Frau hat sich jedoch in dieser Geschichte über Nacht geändert, sondern die innere Befindlichkeit des Mannes.
Oder die Geschichte des Autofahrers, der vorschriftsmäßig 50 fährt, aber sofort schuldbewußt abbremst, als er den Polizisten sieht.
Und schließlich die Geschichte des kleinen Mädchens, das voller Stolz seine rot gepinselten Fingernägel der Mutter zeigen will. Die Mutter wiederum zeigt dem Töchterchen ihre eigenen rot gepinselten Fußnägel, statt es gebührend für sein Tun zu bewundern.
Der Schlüssel zu all diesen Geschichten liegt in Wahrnehmungs- und Übertragungsfehlern, die in Abhängigkeitsverhältnissen typisch sind.
Ich komme mit Abhängigkeit von ArbeitskollegInnen dieser Art nicht zurecht. Sie zementiert formale Hierarchien. Sie formuliert ein Rollenverständnis des Bürgermeisters, das diesen ebenso einzementiert wie die MitarbeiterInnen selbst. Diese Abhängigkeit produziert Hierarchien, mit einer Fehlertoleranz nach oben. Sie verhindert die Courage und wirkliche Delegation von Verantwortung.
Deshalb nahm ich Fehler meines eigenen Verhaltens, wenn sie mir erst nachträglich klar wurden, zum Anlaß für eine selbstkritische spätere Darstellung. Ein gutes Beispiel für die Lernfähigkeit im Mitarbeiterkreis war eine ,Komfis-Runde, die ich angesetzt hatte, um endlich Klarheit zu gewinnen über das seit nunmehr 14 Jahren entwickelte System der Kommunalen Datenverarbeitung im Finanzwesen (Komfis) Ich war an diesem Morgen derart unwirsch, daß ein Mitarbeiter mir die rote Karte mit den Führungsgrundsätzen vor die Nase hielt, die ein solch demotivierendes Verhalten verbietet. Ich bin ihm dankbar und froh, daß es ihm möglich war.
Ich hoffe, ich konnte in den zwölf Jahren den Mitarbeiterinnen der Stadt, mit denen ich näher zu tun hatte, ein wenig von der Bedeutung ihrer Eigenständigkeit und Selbstverantwortung für den Entscheidungsverlauf vermitteln. Es hat Spaß gemacht, um den rechten Weg zu ringen und an ihren persönlichen und sachlichen Einschätzungen teilhaben zu dürfen. Ich habe mich immer auf ihr Urteil verlassen können. Dafür bedanke ich mich. Daß wir gemeinsam schon 1999 das für 2001 gesteckte Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht haben, ist der beste Beweis für das Gelingen des inneren Weges der Reform.
Was für die wechselseitige partnerschaftliche Verfassung der Stadtverwaltung und ihrer Gesellschaften gilt, war und ist für mich im Verhältnis zu den Bürgerinnen vom Anspruch her nicht anders. Mir selbst kommt dabei zustatten, daß ich Menschen mag, vor ihnen keine Angst habe, auch auf mir fremde Menschen zugehen kann und ihnen gerne und mit Gewinn zuhöre.
Meine Beziehung zu Bürgern Lübecks während meiner Dienstzeit begann am 1.Mai im Ratskeller mit Werner Schöntaube, dem Stadtstreicher. Ich hatte ihn im Oktober 1987 unter der Wallbrechtbrücke kennengelernt, als ich jemanden suchte, der vielleicht wissen konnte, ob die Fahrgastschiffe zu dieser Zeit noch dort anlegten. Wir waren ins KIönen gekommen. Später wurde er von einem Waffennarr, dem Unordnung zuwider war, unter der Moltkebrücke erschossen. Sein Schicksal gehört ebenso zu den für mich im Nachhinein symbolträchtigen Begegnungen mit unbekannten Bürgern wie diejenige mit einer älteren Frau, die vor mir in der Fußgängerzone vom Rad stieg und sagte, „Sie sind doch unser Bürgermeister, machen Sie mal den Hosenladen zu". Ich lachte, bedankte mich bei ihr herzlich und brachte die Sache in Ordnung. Wichtig war mir auch die Begegnung mit einem Kollegen der Feuerwehr, den ich kurz nach der Brandkatastrophe von Januar 1996 auf dem Markt traf, und den ich spontan umarmte, und der dann seinen Tränen den Lauf lassen konnte.
Weil ich Bürgern ohne Ansehen der Person gerne begegne, machten mir folgende Art von Geschichten zu schaffen: Meine Frau und ich gingen abends in ein Restaurant bei uns im Domviertel um die Ecke. Gäste brachen gerade auf. Der eine sagte: „Sie sind doch dieser Bürgermeister” und begann ohne erkennbaren Grund mich zu beschimpfen. Als ich mir das verbat, drohte er tätlich zu werden.
Oder der Taxifahrer, der mich neulich nach Hause brachte. Während der Fahrt redeten wir über alles mögliche. Beim Abschied fragte er dann: „Sie sind doch unser Bürgermeister” und fügte hinzu: „Ich habe gar nicht gedacht, daß sie ein so netter Kerl sind”.
Ich erzähle diese Geschichten, weil sie das feindliche Milieu beschreiben, auf das ich teilweise in der Stadt getroffen bin. Ich beklage mich nicht. Durch die Unbeirrbarkeit meiner Entscheidungen in bestimmten für mich grundsätzlichen Feldern und meine Fähigkeit, eine Lage in drastischen Formulierungen zu beschreiben, habe ich oft bestimmte Interessen verletzt und zum Widerspruch herausgefordert. Ich weiß auch, daß sich das Abbild einer öffentlichen Person vom Urbild schnell entfernt und daß die Medien heute für derartige Bilder die Steuerungsfunktion übernommen haben. Rundfunk, Fernsehen und Zeitungen sind an die Stelle der Kirchenzucht getreten, so sagt das treffend der große Staatsrechtslehrer der Weimarer Zeit, Hermann Heller.
Was mich trotz aller solcher Widerstände antreibt, ist (immer noch) der Glaube an eine andere Welt. Eine Welt der Stadt, der europäischen Stadt. Deren Bürger und Bürgerinnen sich ganz persönlich füreinander verantwortlich fühlen. Niemand muß so handeln, wie er handelt. Das Handeln von uns Menschen ist nicht vorherbestimmt. Wir alle können immer auch anders handeln. Dieser Traum, der ja die Wirklichkeit ist, führt nicht auf einen einfachen Weg.
Ich wehrte mich schon als Kind und Schüler gegen Menschen, die sich hinter nur formaler Autorität verstecken. Die Auseinandersetzung mit solchen Persönlichkeiten wiederholte sich später bis heute in allen meinen Ausbildungs- und Berufsfeldern immer wieder. Das war in der ersten Klasse so, als ich es ablehnte, Klassenkameraden im Auftrag des Klassenlehrers zu verpetzen und es setzte sich fort bis zum Abitur, als ich als Schulsprecher des Gymnasiums abgesetzt werden sollte, weil ich mich mit Rücksicht auf einen Mitschüler nicht so verhielt, wie das die Lehrer von mir erwartet hatten. In der Bundeswehr, an der Universität, beim Verwaltungsgericht und in der Stadtverwaltung Bielefeld wiederholten sich ähnliche Lagen.
Ich traf in meinem Umfeld immer wieder auf FunktionsträgerInnen, die mich und andere für ihre Zwecke benutzen wollten. Denen meine Richtung selbständigen Denkens und Handelns nicht paßte. Sie riefen mich zu sich und redeten dann von abstrakten Werten, von dem, was sich gehört oder nicht gehört, von Pflicht, Vertrauen, Loyalität, Gesetz, wie sie es eben für ihre Zwecke auslegten. Sie hätten besser sagen sollen, daß ich die Kreise nicht stören sollte, in denen das Sagen hatten. Den Rektor des Schiller-Gymnasiums in Offenburg werde ich schon deshalb nicht vergessen, weil ich bei einem dieser Führungsgespräche, 1962, in seinem Dienstzimmer von dem eingerahmten Leitspruch hinter seinem Stuhl so fasziniert war: Divide et impera! Teile und Herrsche!
Meine Erfahrung ist es, daß dieser Typus des Vorgesetzten heute zwar abnimmt. Der Wandel hin zum intrinsisch motivierenden Vorgesetzten geschieht aber langsam, für Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere skandinavischen oder etwa Holland viel zu langsam. Denn für kreative Prozesse ist ein derartiger Funktionär umgeeignet. Er lähmt sein Umfeld und wird einfach nicht gebraucht. Das merken sofort auch alle Mitarbeiter, soweit sie eigenständiges Arbeiten mögen.
In Wirklichkeit sieht eine solche Fehlbesetzung, wie im vierten pädagogischen Beispiel die Mutter mit den roten Fußnägeln, immer nur sich selbst. Dahinter verbirgt sich oft eine leicht kränkbare, schnell beleidigte und unsichere Persönlichkeit, die auf Gefolgschaft angewiesen ist und sonst nichts. Keine demokratische Persönlichkeit, wie sie eine europäische Stadt in Führungspositionen braucht.
Ich habe mich immer bemüht, Lübecks Charakter als europäische Stadt nach innen und außen herauszustellen. Zur Außenpolitik gehört es, bestehende Fernbeziehungen zu vertiefen und neue herzustellen. Das beginnt vor unserer Haustür mit den oft vernachlässigten Umlandgemeinden, auf deren Fürsprache wir einfach angewiesen sind und umgekehrt natürlich auch. Deshalb waren die elf Bürgermeisterkonferenzen für die Verständnisbildung in der Region sehr heilsam. Mit HOLM haben wir Enthusiasten nach der Grenzöffnung sehr weit gegriffen. Rosie Wilcken weiß stellvertretend davon zu berichten. Die Zeit für HOLM war der Ost-West-Erfahrungsaustausch nach 1989. Für eine unmittelbare kommunale Zusammenarbeit der Städte und Landkreise zwischen den Metropolen Hamburg und Berlin wird die Zeit sicherlich noch reifen.
In der Ostseeregion tat ich das mir Mögliche eine brauchbare Arbeitsplattform für die Städte herzustellen, etwa als Mitgründer der UBC 1991 und während der achtjährigen Tätigkeit als einer der stellvertretenden Vorsitzenden dieses internationalen Städtebundes, dem heute rund 100 Städte angehören. Für den Hansetag, deren Vorsitzender ich zwölf Jahre sein durfte, habe ich als Abschiedsgeschenk gemeinsam mit Inger Harlevi aus Visby, Manfred Schürkamp aus Herford und vielen anderen hanseatischen Freunden und Freundinnen eine Verfassung erarbeitet, die diese wichtige europäische Institution wirkkräftiger werden lassen wird.
Ich hebe den außenpolitischen Bereich meiner Tätigkeit nicht nur deshalb gerne hervor, weil ich dort viele Freunde gefunden habe. Sondern weil über den unmittelbaren Kontakt mit verschiedenen Kulturen städtischen Lebens quer durch Europa das eigene Urteil Farbe gewinnt. Man erkennt relativ schnell, daß man nicht ein Solitär ist. Weder als Bürgermeister noch als Stadt. Und man lernt ungeheuer schnell, daß man Europäer ist und was das im Einzelnen heißt. Es wird ferner schnell klar, daß sinnvolle Kooperationsentscheidungen auf der Ebene der Städte für Lübeck nützlich sind. Deshalb begrüße ich es, daß die Fachbereiche meiner Bitte Rechnung getragen haben und von sich aus verstärkt in internationale Netzwerke investieren.
Zum Schluß noch drei Herzensangelegenheiten:
Der Hafen. Ich bin froh, daß ich als Aufsichtsratsvorsitzender der LHG die grundsätzlichen Weichenstellungen nach 1988 treffen konnte. In dieser im Vergleich zur Stadtverwaltung kleinen (aber feinen) Organisationseinheit läßt sich vielleicht nochmals darstellen, was ich damit meine, wenn ich davon spreche, die Dinge vom Kopf auf die Füße gestellt zu haben.
Die Hafengesellschaft hätte nach 1989 nicht überlebt, wenn nicht eine Revolutionierung ihres Innenlebens stattgefunden hätte. Wenn wir heute europaweit von integrierten Verkehren sprechen, also davon, daß die knappen Ressourcen Straße, Schiene, Wasser und Luftweg in Europa in optimaler Weise auf Transportgefäße, Produktionsbedingungen, Warenströme, Kundenbedürfnisse und Tarifverträge zugeschnitten werden müssen, dann kommt dem Lübecker Hafen hier die (bisher zu wenig beachtete) Schlüsselfunktion zu. Er hat sich deshalb in den letzten sechs Jahren konsequent aus einem Hardware-Haus in ein Software-Unternehmen verwandelt. Das meine ich im übrigen, wenn ich von der Transformation der Industrie in die Wissensgesellschaft spreche. Ein Prozeß, vor dem Lübeck sich als europäische Stadt noch zu bewähren hat. Die LHG ist ein wirkliches Fernhandelsunternehmen geworden und deshalb im besten Sinne ein hanseatisches Unternehmen. Dafür danke ich allen Mitstreitern und Mitstreiterinnen.
Zweitens: Das Demokratieprojekt. Die Stadt ist der Ort, an dem Demokratie gelernt und gelebt wird, von Kindheit an. Im Elternhaus, Kindergarten, Schule, Ausbildung und Beruf. Was Europa ist, wird dort entweder begriffen oder eben nicht, wo die Menschen sich begegnen und leben. Das ist die Stadt nicht der Staat. Staat hat weder Raum noch Gesicht. Handeln und verantwortlich sein können nur Menschen. Die leben in der Stadt. Die Verwaltung hat sich Ihnen zu nähern. Deshalb hat es mich gefreut, daß ich als letzte Amtshandlung am Mittwoch dieser Woche das dritte Stadtteilbüro in Moisling eröffnen durfte.
Lübeck hat in einer existentiellen Lage gezeigt, daß es weiß, worauf es ankommt. Existentielle Lagen kann eine Stadt sich nicht aussuchen. In den vier schrecklichen Brandjahren ist es ungewollt international zum Fokus geworden. Da gab es im Ergebnis nur eines: Abwehr der Gefahr und Schutz der Betroffenen. Unsere Bürger und Bürgerinnen, vor allem die Jungen haben mir gezeigt, daß wir in der Lage sind, wenn es darauf ankommt, geschlossen das Richtige zu tun. Deshalb habe ich auch Vertrauen in die Fähigkeit der Stadt, sich im europäischen Sinne zu erneuern.
Drittens der Dank: Er gilt der Bürgerschaft und den Lübeckern und Lübeckerinnen. Ich durfte mich mit Ihnen ausprobieren. Das tat zeitweise sehr weh. Aber ohne Reibung gibt es keine Wärme, ohne Narben kein Leben. Karin Klagemann hat das alles aus nächster Nähe miterlebt, mich beschützt und organisiert, soweit das überhaupt möglich war, dafür gilt ihr stellvertretend für alle MitarbeiterInnen und KollegInnen besonderer Dank. Herrn Rischau, danke ich seine beständige Fairniss, Offenheit und Kollegialität. Frau, Söhne, Freunde und. Freundinnen, auch unter den MitarbeiterInnen, brauchte ich zum Lachen und Weinen. Sie waren da. Inger Harlevi und Rosemarie Wilcken stehen stellvertretend für unsere Nachbarn, die der Stadt und mir immer freundschaftlich gewogen waren. Das soll so bleiben.
Dr. Knüppel hat mir vor zwölf Jahren die Inschrift des Holstentores mit auf den Weg gegeben. Ich möchte Ihnen, Herr Saxe, die Inschrift der Schiffergesellschaft ans Herz legen: Allen zu gefallen ist unmöglich.
Ich habe mich auch als Bürgermeister nie als Staatsmann gefühlt sondern als Stadtmensch. Jetzt freue ich mich darauf, ab 1. Mai ein Bürger von 215 336 zu sein. Das ist der Stand vom 31.3.2000.”
+++