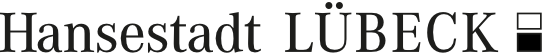990955R 10. Dezember 1999
Der Schriftsteller und sein Antrieb zum Schreiben / Die Rede von Günter Grass in Stockholm zur Verleihung des Literaturnobelpreises am 10. Dezember 1999
Am Dienstagabend, 6. Dezember, bedankte sich der Schriftsteller Günter Grass in Stockholm mit einer Rede für die Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis vor der "Royal Academie". Am heutigen Freitag wird die Ehrung offiziell vorgenommen werden. Wir dokumentieren den Vortrag von Günter Grass in der schriftlich verbreiteten Fassung. Der geehrte Autor schildert darin seinen schriftstellerischen Werdegang und die Bedeutung von Literatur für ihn selbst und die Gesellschaft.
Verehrte Mitglieder der Schwedischen Akademie, meine Damen und Herren!
"Fortsetzung folgt..." Mit dieser Ankündigung zogen sich im neunzehnten Jahrhundert Prosawerke in die Länge. Unterm Strich boten Journale und Wochenblätter Platz. Der Fortsetzungsroman stand in Blüte. Während in rascher Folge Kapitel nach Kapitel schwarz auf weiß gedruckt wurden, war der Mittelteil der Erzählung gerade erst handschriftlich zu Papier gekommen, der Schlußteil noch nicht ausgedacht. Doch hielten nicht nur triviale Schauergeschichten und herzergreifende Passionen den Leser in Bann.
Etliche Dickens-Romane sind so, in Häppchen, erschienen. Tolstois "Anna Karenina" war ein Fortsetzungsroman. Balzacs Zeit als fleißiger Zulieferer für fortgesetzte Massenware mag ihn, noch namenlos, die Technik erhöhter Spannung, knapp vor dem Abbruch der Spalte, gelehrt haben. Und auch fast alle Fontane-Romane sind zuerst in Zeitungen und Zeitschriften abgedruckt und fortgesetzt worden, zum Beispiel "Irrungen, Wirrungen", auf daß der Besitzer der "Vossischen Zeitung" empört ausrief: "Will denn diese Hurengeschichte nicht endlich aufhören!" Doch bevor ich den Faden meiner Rede dergestalt weiterspinne oder zu Nebenfäden aufdrösele, soll erwähnt werden, daß mir, rein literarisch gesichtet, dieser Saal und die einladende Schwedische Akademie nicht fremd sind. In meinem Roman "Die Rättin", der vor bald vierzehn Jahren erschienen ist und an dessen katastrophalen Verlauf auf abschüssigen Erzählebenen sich der eine oder andere Leser erinnern mag, wird in Stockholm eine Laudatio vor vergleichbar gemischter Gesellschaft gehalten, die der Ratte, genauer gesagt der Laborratte, gewidmet ist.
Sie hat den Nobelpreis erhalten. Endlich, muß man sagen. Denn auf den Vorschlagslisten stand sie lange schon. Sie galt als favorisiert. Stellvertretend für Millionen Versuchstiere von den Meerschweinchen bis zu den Rhesusaffen ist nun sie, die weißhaarige, rotäugige Laborratte, geehrt worden. Sie, vor allen anderen sie – das behauptet der Erzähler in meinem Roman –, hat all die nobelierten Forschungen und Erfindungen auf dem Gebiet der Medizin und was die Entdeckungen der Nobelpreisträger Watson und Crick betrifft, auf dem schier unbegrenzten Versuchsacker der Genmanipulation möglich gemacht. Seitdem darf mehr oder minder legal geklont werden, Mais, Gemüse, aber auch allerlei Getier. Deshalb heißen die gegen Ende des besagten Romans, also während posthumaner Zeit, immer dominanter in Erscheinung tretenden Rattenmenschen "Watsoncricks". In ihnen ist das beste aus beiden Gattungen vereint. Das Rattige west im Menschen und umgekehrt. Am Wesen dieser Züchtung scheint die Welt genesen zu wollen. Wurde auch Zeit, daß nach dem Großen Knall, als nur Ratten, Kakerlaken und Schmeißfliegen, ein Rest Fisch- und Froschlaich überlebten, dem Chaos wieder Ordnung beigebracht wurde, und zwar mit Hilfe der Watsoncricks, die wunderbarerweise davonkamen.
Da aber diesem Erzählstrang ein "Fortsetzung folgt ..." offen stand und die Nobelpreisrede auf die Laborratte nicht etwa als heiteres Schlußstück den Roman beschließt, kann ich mich nun grundsätzlich dem Erzählen als Überlebens- und Kunstform zuwenden.
Von Anfang an wurde erzählt. Lange bevor sich das Menschengeschlecht im Schreiben übte und nach und nach alphabetisierte, erzählte jeder jedem, und jeder hörte dem anderen zu. Bald gab es unter den noch nicht Schreibkundigen solche, die mehr und besser erzählten oder glaubhafter lügen konnten. Und unter ihnen gab es hinwiederum solche, denen es kunstvoll gelang, den Fluß ihrer Erzählung nach ruhigem Dahinfließen zu stauen, dann die gestaute Stoffmasse über die Ufer treten zu lassen, ihr einen verzweigten Verlauf zu geben, der nie versickerte, sondern plötzlich und überraschend ein breites Flußbett fand, nun freilich viel Treibgut mitführend, das Nebenhandlungen zur Folge hatte. Und weil diese allerfrühesten Erzähler, die auf Tages- oder Lampenlicht nicht angewiesen waren und noch im Dunkeln gut munkeln konnten, ja, der Dunkelheit oder dem Dämmern zusätzliche Spannung abzugewinnen wußten, keine Durststrecken, keinen donnernden Wasserfall scheuten und allenfalls aus Gründen allseits aufkommender Müdigkeit mit dem Versprechen "Fortsetzung folgt ..." den Ablauf der Handlung unterbrachen, fanden sich viele Zuhörer ein, die zwar auch, aber nicht so unerschöpflich zu erzählen wußten.
Was wurde, als noch niemand schreiben, aufschreiben konnte, erzählt? Von Anbeginn, seit Kain und Abel, wird viel von Mord und Totschlag die Rede gewesen sein. Rache, besonders die Blutrache, bot Stoff. Und früh schon war Völkermord gang und gäbe. Aber auch von Wasserfluten und Dürrezeiten, von mageren und fetten Jahren konnte berichtet werden. Man scheute keine langwierigen Aufzählungen von Besitz an Vieh und Menschen. Keine Erzählung durfte, wenn sie als glaubwürdig gehört werden wollte, auf lange Geschlechterlisten – wer nach wem und vor wem kam – verzichten. Ähnlich geschlechterkundig bauten sich Heldengeschichten auf. Sogar die bis heute beliebten Dreiecksgeschichten, aber auch Ungeheuerliches, in dem Wesen, gemischt aus Mensch und Tier, Labyrinthe beherrschten oder im Uferschilf lauerten, werden dazumal schon erzählte Massenware gewesen sein. Ganz zu schweigen von Götter und Götzenlegenden sowie abenteuerlichen Schiffsreisen, die erzählend weitergereicht, abgeschliffen, ergänzt, variiert, ins Gegenteil verkehrt wurden und schließlich von einem Erzähler, der Homer geheißen haben soll, oder von einem Erzählerkollektiv – was die Bibel betrifft – aufgeschrieben worden sind. Seitdem gibt es die Literatur. In China, Persien, Indien, auf dem peruanischen Hochland und andernorts, wo überall Schrift entstand, sind es Erzähler gewesen, die sich als Literaten vereinzelt oder im Kollektiv einen Namen gemacht haben oder anonym geblieben sind.
Erhalten hat sich für uns, die wir so extrem schriftlich fixiert sind, die Erinnerung an das mündliche Erzählen, an den oralen Ursprung der Literatur. Doch sollten wir vergessen haben, daß alles Erzählen von Anbeginn über die Lippen gekommen ist, mal gaumig, stockend, dann wieder hastend, wie von Angst getrieben, auch flüsternd, als müsse das preisgegebene Geheimnis vor allzu vielen Mitwissern geschützt werden, nun wiederum laut, zwischen auftrumpfenden Ausrufen oder Fragen, die schon immer mit gebogenem Rüssel den ersten und letzten Dingen nachschnüffelten – sollten wir all das schriftgläubig vergessen haben, dann wäre unser Erzählen papieren nur und nicht von feuchtem Atem getragen.
Wie gut, daß uns Bücher genug zur Hand sind, die, leise wie laut gelesen, Bestand haben. Sie waren mir beispielhaft. Meister wie Melville oder Döblin, aber auch Luthers Bibeldeutsch, haben mich, als ich jung und belehrbar war, angestoßen, vor mich hin sprechend zu schreiben, die Tinte mit der Spucke zu mischen. Und dabei ist es geblieben. Bis ins fünfte Jahrzehnt meiner lustvoll ertragenen Schreibfron kaue ich zähfaserige Satzgefüge zu fügsamem Brei, brabbel in schönster Schreibeinsamkeit vor mich hin und lasse nur zu Papier kommen, was auch gesprochen seine wechselnde Tonlage gefunden, Hall und Echo bewiesen hat.
Ja, ich liebe meinen Beruf. Er verschafft mir Gesellschaft, die vielstimmig zu Wort kommen und möglichst wortgetreu ins Manuskript finden will. Am liebsten begegne ich meinen mir vor Jahren entlaufenen oder vom Leser enteigneten Büchern, wenn ich vor Zuhörern lese, was geschrieben und ausgedruckt zur Ruhe kam. Dann, dem jungen, schon früh der Sprache entwöhnten, dem altersgrauen, doch immer noch nicht gesättigten Publikum gegenüber, wird das geschriebene und ausgedruckte Wort wieder zum gesprochenen. Und die Verzauberung gelingt Mal um Mal. So verdient sich der Schamane im Schriftsteller sein Zubrot. Er, der gegen die verstreichende Zeit schreibt, er, der sich haltbare Wahrheiten zusammenlügt, ihm glaubt man sein unausgesprochenes Versprechen: Fortsetzung folgt ...
Doch wie wurde ich Schriftsteller, Dichter, Zeichner – und alles zugleich auf erschreckend weißem Papier? Welch hausgemachte Hybris vermochte ein Kind zu solcher Verstiegenheit anzustiften? Denn ich war etwa zwölf Jahre alt, als für mich feststand, Künstler werden zu wollen. Das war, als bei uns zu Hause, ganz nahe dem Vorort Danzig-Langfuhr, der Zweite Weltkrieg begann. Die fachliche Spezialisierung in Richtung Dichter bildete sich erst im folgenden Kriegsjahr aus, als mir in der Zeitschrift der Hitlerjugend "Hilf mit!" ein verlockendes Angebot gemacht wurde: Ein Erzählwettbewerb stand ausgeschrieben. Preise wurden versprochen. Und sogleich begann ich meinen ersten Roman in ein Diarium zu schreiben. Er trug, beeinflußt durch den familiären Hintergrund meiner Mutter, den Titel "Die Kaschuben", spielte aber nicht in der dem verschwindend kleinen Kaschubenvolk wieder einmal schmerzlichen Gegenwart, sondern im dreizehnten Jahrhundert, zur Zeit des Interregnums, der kaiserlosen, der schrecklichen Zeit, in der Wegelagerer und Raubritter Straßen und Brücken beherrschten und sich die Bauern nur durch eigenes Recht, durch Femegerichte zu helfen wußten.
So viel erinnere ich, daß nach kurzer Darstellung der wirtschaftlichen Lage im kaschubischen Hinterland sogleich die Räuberei und mit ihr das Hauen und Stechen begann. Dergestalt heftig wurde gewürgt, erdolcht, aufgespießt und durch Femespruch mit Galgen oder Schwert gerichtet, daß gegen Ende des ersten Kapitels alle Hauptdarsteller und ein Gutteil der Nebenpersonen tot, verscharrt oder den Krähen als Fraß vorgeworfen waren. Da mir mein Stilgefühl nicht erlaubte, die angehäuften Toten als Geister handeln und den Roman ins Schauerliche vorantreiben zu lassen, mußte mein Versuch als gescheitert gelten, war dem "Fortsetzung folgt ..." ein jähes Ende gesetzt; nicht für immer und alle Zeit, aber der Anfänger wurde mit der deutlichen Ermahnung geimpft, beim zukünftigen Erzählen behutsamer und ökonomischer mit dem fiktiven Personal umzugehen.
Doch vorerst las ich in mich hinein. Ich las auf besondere Weise: mit den Zeigefingern in den Ohren. Erklärend muß dazu gesagt werden, daß meine jüngere Schwester und ich in beengten Verhältnissen, nämlich in einer Zweizimmerwohnung, also ohne eigene Kammer oder sonst einen noch so winzigen Verschlag aufgewachsen sind. Auf Dauer gesehen war das für mich von Vorteil, denn so lernte ich früh, mich inmitten von Personen und umgeben von Geräuschen dennoch zu konzentrieren. Wie unter einer Käseglocke aufgehoben, war ich so ans Buch und dessen erzählte Welt verloren, daß meine Mutter, die zu Scherzen neigte, nur um einer Nachbarin die gänzliche Absenz ihres Sohnes zu beweisen, eine Butterstulle, die neben meinem Buch lag und in die ich ab und zu biß, gegen ein Stück Seife – nehme an, Palmolive – eintauschte, woraufhin beide Frauen – meine Mutter mit gewissem Stolz – Zeugen wurden, wie ich, ohne den Blick vom Buch zu lösen, nach der Seife griff, zubiß und kauend eine gute Minute brauchte, um aus dem gedruckten Geschehen geworfen zu werden.
Solch frühe Einübung in konzentriertes Verhalten ist mir noch heute geläufig; doch nie wieder habe ich so besessen gelesen. Die Bücher fanden sich in einem Schränkchen hinter blauen Scheibengardinen. Meine Mutter war Mitglied in einem Buchclub. Dostojewskis und Tolstois Romane standen dort neben und zwischen einigen von Hamsun, Raabe und Vicki Baum. Auch Selma Lagerlöfs "Gösta Berling" war greifbar. Später fütterte mich die Stadtbibliothek. Doch den Anstoß hat wohl der Bücherschatz meiner Mutter gegeben. Sie, die genau rechnende Geschäftsfrau, die ihren Kolonialwarenladen zu Diensten unzuverlässiger Pumpkundschaft betrieb, liebte das Schöne, lauschte dem Volksempfängerradio Opern- und Operettenmelodien ab, hörte gerne meine vielversprechenden Geschichten, ging oft ins Stadttheater und nahm mich manchmal mit.
Aber diese nur flüchtig skizzierten Anekdoten, erlebt in der Enge kleinbürgerlicher Verhältnisse, die ich vor Jahrzehnten an anderer Stelle und mit fiktivem Personal episch breit ausgemalt habe, sind einzig dazu gut, mir bei der Beantwortung der Frage "Wie wurde ich Schriftsteller?" behilflich zu werden. Die Fähigkeit zur anhaltenden Tagträumerei, die Lust am Wortwitz und am Spiel mit Wörtern, die Sucht, nur deshalb und ohne Vorteil für sich zu lügen, weil das Schildern der Wahrheit zu langweilig gewesen wäre, kurz, was man vage genug Begabung nennt, war gewiß vorgegeben, doch ist es der jähe Einbruch der Politik ins familiäre Idyll gewesen, der dem allzu leicht dahinsegelnden Talent zu dauerhaftem Ballast und einigem Tiefgang verhalf.
Die Lieblingscousin meiner Mutter, wie sie kaschubischer Herkunft, war im Freistaat Danzig Beamter der polnischen Post. Er ging bei uns ein und aus, war gerngesehener Besuch. Als bei Kriegsbeginn das Postgebäude am Heveliusplatz gegen den Ansturm der SS-Heimwehr eine Zeitlang verteidigt wurde, gehörte mein Onkel zu den Kapitulierenden, die alle standrechtlich verurteilt und erschossen worden sind. Plötzlich fehlte dieser Onkel. Plötzlich und anhaltend sprach man nicht mehr von ihm. Er blieb ausgespart. Doch indem er wie weg war, muß er sich bei mir festgesetzt haben, unbemerkt über Jahre hinweg, in denen ich mit fünfzehn in Uniform steckte, mit sechzehn mich zu fürchten lernte, mit siebzehn in amerikanische Kriegsgefangenschaft geriet, mit achtzehn in Freiheit und als Schwarzhändler tätig war, schließlich den Beruf des Steinmetz und Steinbildhauers lernte, mich auf Kunstakademien übte, schrieb und zeichnete, zeichnete und schrieb, leichtfüßige Verse, windgeblasen, skurrile Einakter. Das ging so fort, bis mir, dem das ästhetische Vergnügen wie eingeboren war, eine Stoffmasse sperrig wurde. Und unter ihrem Geröll lag der Lieblingscousin meiner Mutter, der erschossene polnische Postbeamte, begraben, um von mir – von wem sonst? – gefunden, ausgebuddelt zu werden, auf daß er unter anderem Namen und in anderer Gestalt mittels Erzählbeatmung wieder zum Leben erweckt wurde; diesmal jedoch in einem Roman, dessen Haupt- und Nebenfiguren lebensgierig und putzmunter viele Kapitel überlebten, wobei einige sogar bis zum Ende aushielten, so daß des Schriftstellers ständiges Versprechen "Fortsetzung folgt ..." eingelöst werden konnte.
Und so weiter und so weiter. Mit der Veröffentlichung meiner ersten beiden Romane "Die Blechtrommel" und "Hundejahre" und der dazwischengeschobenen Novelle "Katz und Maus" lernte ich früh, als immer noch relativ junger Schriftsteller, daß Bücher Anstoß erregen, Wut, Haß freisetzen können. Was aus Liebe dem eigenen Land zugemutet ward, wurde als Nestbeschmutzung gelesen. Seitdem gelte ich als umstritten.
Dabei befinde ich mich, was nach Sibirien oder sonstwohin verwünschte Schriftsteller betrifft, in guter Gesellschaft. Wir sollten uns deswegen nicht beklagen. Vielmehr dürfen wir den Zustand des permanenten Umstrittenseins als belebend empfinden und auch dem Risiko unserer Berufswahl angemessen. Es ist nun mal so, daß die Autoren des bloßen Wortgeschehens den Mächtigen, die stets auf der Siegerbank ihr Platzrecht behaupten, gerne und wohlbedacht in die Suppe spucken, weshalb die Geschichte der Literatur sich analog zur Entwicklung und Verfeinerung der Zensurmethoden verhält.
Der Machthaber Mißlaune zwang Sokrates, den Giftbecher bis zur Neige zu leeren, trieb Ovid in die Verbannung, nötigte Seneca, seine Pulsadern zu öffnen. Die schönsten literarischen Früchte, gewonnen aus abendländischer Kulturgärtnerei, zierten namentlich den Index der katholischen Kirche, während Jahrhunderten und bis heutzutage. Welches Ausmaß an Verzögerung hat die europäische Aufklärung durch die Zensurmaßnahmen absolut herrschender Fürsten erfahren? Wie viele deutsche, italienische, spanische und portugiesische Schriftsteller hat der Faschismus aus ihren Ländern, ihren Sprachräumen vertrieben? Wie viele Schriftsteller sind Opfer des leninistisch-stalinistischen Terrors geworden? Und welchen Zwängen sind Schriftsteller heute noch, ob in China, Kenia oder Kroatien, ausgesetzt?
Ich komme aus dem Land der Bücherverbrennung. Wir wissen, daß die Lust, das verhaßte Buch in dieser oder jener Form zu vernichten, immer noch oder schon wieder dem Zeitgeist gemäß ist und gelegentlich telegenen Ausdruck, das heißt Zuschauer findet. Weit schlimmer jedoch ist, daß die Verfolgung von Schriftstellern bis hin zur angedrohten oder vollzogenen Ermordung in aller Welt zunimmt und sich alle Welt an diesen fortgesetzten Terror gewöhnt hat. Jener Teil der Welt, der sich frei nennt, schreit zwar empört auf, wenn in Nigeria, wie 1995 geschehen, der die Verseuchung seiner Heimat anklagende Schriftsteller Ken Saro-Wiwa mit seinen Mitstreitern zum Tode verurteilt und dieses Urteil vollstreckt wird, geht aber dann zur Tagesordnung über, weil ökologisch begründeter Protest die Geschäfte des global herrschenden Ölgiganten Shell stören könnte.
Was jedoch macht Bücher und mit ihnen Schriftsteller dergestalt gefährlich, daß Staat und Kirche, Medienkonzerne und Politbüros sich zu Gegenmaßnahmen gezwungen sehen? Selten sind es direkte Verstöße gegen die jeweils herrschende Ideologie, denen Schweigegebot und Schlimmeres folgen. Oft reicht der literarische Nachweis, daß die Wahrheit nur im Plural existiert – wie es ja auch nicht nur eine Wirklichkeit, sondern eine Vielzahl von Wirklichkeiten gibt –, um einen solch erzählerischen Befund als Gefahr zu werten, als eine tödliche für die jeweiligen Hüter der einen und einzigen Wahrheit. Auch daß Schriftsteller – was ihres Berufes ist – die Vergangenheit nicht ruhen lassen können, zu schnell vernarbte Wunden aufreißen, in versiegelten Kellern Leichen ausgraben, verbotene Zimmer betreten, heilige Kühe verspeisen oder wie Jonathan Swift es getan hat, irische Kinder als Rostbraten der herrschaftlich englischen Küche empfehlen, ihnen also generell nichts, selbst nicht der Kapitalismus heilig ist, all das macht sie anrüchig, strafwürdig. Ihr schlimmstes Vergehen jedoch bleibt, daß sie sich in ihren Büchern nicht mit den jeweiligen Siegern im historischen Verlauf gemein machen wollen, sich vielmehr dort mit Vergnügen herumtreiben, wo die Verlierer geschichtlicher Prozesse am Rande stehen, zwar viel zu erzählen hätten, doch nicht zu Wort kommen. Wer ihnen Stimme gibt, stellt den Sieg in Frage. Wer sich mit Verlierern umgibt, gehört zu ihnen.
Gewiß haben die Mächtigen, gekleidet in dieses oder jenes Zeitkostüm, generell nichts gegen die Literatur. Sie wünschen sich sogar eine als Zimmerschmuck und sind bereit, sie zu fördern. Gegenwärtig soll sie unterhaltsam sein, der Spaßkultur dienlich, also nicht nur das Negative sehen, vielmehr den Menschen in ihrer Not ein Hoffnungslichtlein stecken. Im Grunde war und ist, wenn auch nicht so explizit gefordert wie zu Zeiten des Kommunismus, der "positive Held" erwünscht. Der kann heutzutage im unbegrenzten Dschungel der freien Marktwirtschaft durchaus rambomäßig daherkommen und seinen Weg zum Erfolg lachend mit Leichen pflastern; ein Bruder Leichtfuß, der zwischen Schußwechsel und Schußwechsel zu einem schnellen Fick bereit ist, ein Winner, der lauter Loser hinter sich läßt, kurzum ein Held, der unserer globalisierten Welt seine positiven Duftmarken setzt. Und dem Wunsch nach derart hartgesottenen Stehaufmännchen wird auch mittels allzeit verfügbarer Medien entsprochen: James Bond hat viele ihm dollygleiche Kinder geheckt. Nach seiner Machart – als cooler Typ – darf weiterhin das Gute über das Böse siegen.
Also wäre sein Gegenbild oder Gegenspieler der negative Held? Nicht unbedingt. Ich komme, wie Sie lesend erfahren haben, aus der maurisch-spanischen Schule des pikaresken Romans. In ihr ist der Kampf gegen Windmühlenflügel ein durch die Jahrhunderte hindurch übertragbares Modell geblieben. Also lebt der Pikaro von der Komik des Scheiterns. Sein Witz pinkelt an die Säulen der Macht, sägt an deren Gestühl, weiß aber zugleich, daß er weder den Tempel zum Einsturz noch den Thron zum Kippen bringen wird. Nur sieht das Erhabene, sobald mein Pikaro vorbeigeschlendert ist, ziemlich schäbig aus, und der Thron wackelt ein wenig. Sein Humor ist der Verzweiflung abgewonnen. Während sich in Bayreuth die "Götterdämmerung," vor hochkarätigem Publikum in die Länge zieht, hört man ihn kichern, denn in seinem Theater laufen Komödie und Tragödie Hand in Hand. Er verspottet die schicksalhaft daherschreitenden Sieger und bringt sie ins Stolpern.
Zwar macht sein Scheitern uns lachen, doch ist das von ihm ausgelöste Gelächter von sperriger Qualität: es bleibt im Hals stecken; selbst seine witzigst zugespitzten Zynismen sind von tragischem Zuschnitt. Zudem ist er aus der Sicht rot oder schwarz eingefärbter Beckmesser ein Formalist, ja, Manierist erster Güte: Er hält das Fernglas verkehrt herum. Die Zeit rangiert bei ihm auf einem Verschiebebahnhof. Allerorts stellt er Spiegel auf. Nie weiß man, wessen Bauchredner er jetzt ist. Der reizvollen Perspektive wegen sind in des Pikaro Manege manchmal sogar Zwerge und Riesen zugange. So ist Rabelais zeit seines tätigen Lebens auf der Flucht vor profaner Polizei und der heiligen Inquisition gewesen, weil seine überlebensgroßen Kerle Gargantua und Pantagruel die nach scholastischer Lehre geordnete Welt auf den Kopf gestellt hatten. Welch ein Höllengelächter haben die beiden entfesselt! Und als Gargantua breitärschig auf den Türmen von Notre-Dame hockte und von dort herab pissend ganz Paris unter Wasser setzte, lachte das Volk, sofern es nicht ersoffen war. Oder noch einmal Swift als Zeuge herbeigerufen: sein kulinarisch gewürzter Vorschlag, die Hungersnot in Irland zu mildern, könnte zeitgemäß aufgegriffen werden, indem beim nächsten Weltwirtschaftsgipfel, sobald den Staatsoberhäuptern der Tisch gedeckt ist, nun nicht mehr die Kinder irischer Hungerleider sondern brasilianische Straßenkinder oder solche aus dem südlichen Sudan köstlich zubereitet serviert werden. Satire heißt diese Kunstform. Sie darf bekanntlich alles, sogar mit dem Entsetzlichen den Lachnerv kitzeln.
Als Heinrich Böll am 2. Mai 1973 hier seine Nobelvorlesung hielt, in der er die so gegensätzlich anmutenden Positionen Vernunft und Poesie in immer enger führender Umkreisung zur Konfrontation brachte, beklagte mit letztem Satz seiner Rede ein Versäumnis aus Zeitgründen: "Übergehen müßte ich den Humor, auch kein Klassenprivileg ist und doch ignoriert wird in seiner Poesie als Versteck des Widerstands." – Nun, Heinrich Böll wußte, wie seitab kaum noch gelesen Jean Paul im Panoptikum deutscher Geistesgrößen seinen Platz hat sehr Thomas Manns literarisches Werk, damals rechter wie linker Sicht, unter Ironieverdacht stand; und ich ergänze: heute noch steht. Böll meinte gewiß nicht den gängigen Schmunzelhumor, wohl aber das unhörbare Lachen zwischen Zeilen, chronische Traueranfälligkeit seines Clowns, verzweifelte Komik jenes Sammlers, Schweigen archivierte. Eine Tätigkeit übrigens, die in den oft berufenen Medien Sinne der Ankündigung "Fortsetzung folgt ..." Schule gemacht hat und als "Freiwillige Selbstkontrolle" freien Westens gefällige Verkleidung Zensur ist.
Zu Beginn der fünfziger Jahre, als ich bewußt zu schreiben begonnen hatte, war Heinrich Böll bereits ein bekannter, wenn auch nicht anerkannter Autor. Mit Wolfgang Koeppen, Günter Eich und Arno Schmidt stand er abseits des damals restaurativen Kulturbetriebs. Die noch junge Nachkriegsliteratur tat sich schwer mit der deutschen Sprache, die unter der Herrschaft des Nationalsozialismus korrumpiert worden war. Zudem stand Bölls Generation, aber auch den jüngeren Autoren, zu denen ich mich zählte, ein Satz von Theodor Adorno als Verbotstafel im Wege. Ich zitiere: "Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, und das frißt auch die Erkenntnis an, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben ... "
Also kein "Fortsetzung folgt ..." mehr. Nun, wir haben dennoch geschrieben. Freilich, indem wir – wie Adorno in seinem Buch von 1951, "Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben" – Auschwitz als Zäsur und unheilbaren Bruch der Zivilisationsgeschichte begreifen mußten. Nur so war diese Verbotstafel zu umgehen. Und doch ist das von Adorno gesetzte Menetekel bis heute wirksam geblieben. An ihm haben sich die Autoren meiner Generation in erklärter Abwehr gerieben. Schweigen wollte, konnte keiner. Ging es doch darum, die deutsche Sprache aus dem Gleichschritt zu bringen, sie aus Idyllen und blaustichiger Innerlichkeit herauszulocken. Uns, den gebrannten Kindern, kam es darauf an, den absoluten Größen, dem ideologischen Weiß oder Schwarz abzuschwören. Zweifel und Skepsis standen Pater; die Vielzahl der Grauwerte reichten sie uns als Geschenk. Ich jedenfalls habe mir diese Askese auferlegt, um dann erst den Reichtum meiner allzu pauschal schuldig gesprochenen Sprache, ihre verführbare Weichheit, ihren vergrübelten Hang zum Tiefsinn, ihre durchaus biegsame Härte, ja, ihren mundartlichen Schmelz, ihre Einfalt und Vieldeutigkeit, ihre Verschrobenheiten und ihre in Konjunktiven aufblühende Schönheit zu entdecken. Mit diesem wiedergewonnenen Pfund galt es zu wuchern, trotz Adorno oder ermahnt durch Adornos Verdikt. Nur so konnte das Schreiben nach Auschwitz – ob Gedicht oder Prosa – fortgesetzt werden. Nur so, indem sie zum Gedächtnis wurde und die Vergangenheit nicht enden ließ, konnte die deutschsprachige Nachkriegsliteratur die allgemeingültige Schreibregel "Fortsetzung folgt ..." für sich und gegenüber den Nachgeborenen rechtfertigen. Und nur so gelang es, die Wunde offen zu halten und das gewünschte wie verordnete Vergessen durch ein beharrliches "Es war einmal ..." aufzuheben.
Wie oft auch aus diesem oder jenem Interesse der Schlußstrich gefordert, die Rückkehr zur Normalität eingeklagt wurde und die schändliche Vergangenheit als Historie abgelegt werden sollte, die Literatur widersetzte sich diesem so verständlichen wie törichten Verlangen. Zu Recht! Denn jedesmal, wenn in Deutschland die Stunde Null verkündigt, das Ende der Nachkriegszeit ausgerufen worden ist – zuletzt vor zehn Jahren, als die Mauer gefallen war und Deutschlands Einheit auf dem Papier stand –, hat uns die Vergangenheit wieder eingeholt.
Zu jener Zeit, im Februar 1990, habe ich in Frankfurt am Main vor Studenten eine Vorlesung unter dem Titel "Schreiben nach Auschwitz" gehalten. Ich zog Bilanz, legte, Buch nach Buch, Rechenschaft ab. So kam ich zu dem 1972 erschienenen "Tagebuch einer Schnecke", in dem Vergangenheit und Gegenwart sich mehrgleisig kreuzen, aber auch parallel zueinander verlaufen und manchmal kollidieren. In diesem Buch steht, weil die Definition meines Berufes von meinen Söhnen erfragt wird, die Antwort: "Ein Schriftsteller, Kinder, ist jemand, der gegen die verstreichende Zeit schreibt." Ich sagte zu den Studenten: "Eine so akzeptierte Schreibhaltung setzt voraus, daß sich der Autor nicht als abgehoben oder in Zeitlosigkeit verkapselt, sondern als Zeitgenosse sieht, mehr noch, daß er sich den Wechselfällen verstreichender Zeit aussetzt, sich einmischt und Partei ergreift. Die Gefahren solcher Einmischung und Parteinahme sind bekannt: Die dem Schriftsteller gemäße Distanz droht verlorenzugehen; seine Sprache sieht sich versucht, von der Hand in den Mund zu leben; die Enge jeweils gegenwärtiger Verhältnisse kann auch ihn und seine auf Freilauf trainierte Vorstellungskraft einengen, er läuft Gefahr, in Kurzatmigkeit zu geraten."
Das damals angesprochene Risiko ist mir über die Jahrzehnte hinweg treu geblieben. Doch was wäre der Beruf des Schriftstellers ohne Risiko? Gut, gleich einem Literaturbeamten könnte er sich als gesichert begreifen. Aber der Gegenwart gegenüber wäre er ein Gefangener seiner Berührungsängste. Aus Angst, die Distanz zu verlieren, verliefe er sich im Weitentlegenen, wo nur noch die Mythen wabern und das Erhabene sich selbst feiert. Nein, die ständig Vergangenheit werdende Gegenwart wird ihn einholen und ins Verhör nehmen. Denn jeder Schriftsteller ist in seine Zeit hinein geboren, er mag noch so heftig beteuern, zu früh oder zu spät gekommen zu sein. Nicht er stellt sich selbstherrlich das Thema seiner Wahl, vielmehr ist es ihm vorgegeben. Ich jedenfalls habe nicht frei entscheiden können. Denn wäre es einzig mir und meinem Spieltrieb zufolge gegangen, hätte ich mich nach rein ästhetischen Gesetzen erprobt und so unbeschwert wie harmlos im Skurrilen meine Rolle gefunden.
Aber das ging nicht. Widerstände waren da. Aus deutscher Geschichtsträchtigkeit geworfen, lagen Trümmer- und Kadaverberge zuhauf. Diese Stoffmasse, die sich, indem ich sie abzutragen begann, vergrößerte, war nicht wegzublinzeln. Zudem komme ich aus einer Flüchtlingsfamilie. Deshalb hat sich zu allem, was einen Schriftsteller von Buch zu Buch antreiben mag – üblicher Ehrgeiz, Furcht vor Langeweile, das Triebwerk der Egozentrik –, die Gewißheit vom unwiederbringlichen Verlust der Heimat als anstiftende Kraft bewiesen. Erzählend sollte die zerstörte, verlorene Stadt Danzig, nein, nicht zurückgewonnen, jedoch beschworen werden. Diese Schreibobsession hat mich angestachelt. Ich wollte, nicht frei von Trotz, mir und meinen Lesern ins Bild bringen, daß das Verlorene nicht spurlos im Vergessen versinken muß, vielmehr durch die Kunst der Literatur wieder Gestalt gewinnen kann: in all seiner Größe und jämmerlichen Kleinlichkeit, mit seinen Kirchen und Friedhöfen, den Geräuschen der Schiffswerften und dem Geruch der matt anschlagenden Ostsee, mit einer längst verebbten Sprache, diesem stallwarmen Gemaule, mit Sünden, die zur Beichte taugten, und seinen geduldeten und verschuldeten Verbrechen, denen keine Beichte die erwünschte Absolution erteilen konnte.
Verlust dieser Art ist auch anderen Schriftstellern zum Mistbeet fortgesetzt obsessionshaften Erzählens geworden.
Jedenfalls kamen vor Jahren Salman Rushdie und ich gesprächsweise überein, daß ihm, wie mir mein verlorenes Danzig, sein verlorenes Bombay Quelle und Müllgrube, Fixpunkt und Weltmitte ist. Diese Anmaßung, diese Verstiegenheit, gehört zur Literatur. Sie bleibt Voraussetzung für ein Erzählen, das befähigt ist, alle Register zu ziehen. Mit ziselierter Kleinkunst feinsinniger Psychologisierung oder mit einem Realismus, der sich als naturgetreuer Abklatsch mißversteht, ist solch monströsen Stoffmassen nicht beizukommen. Sosehr wir aus aufklärender Tradition der Vernunft verpflichtet sind, der absurde Verlauf der Geschichte spottet jeder nur vernünftigen Erklärung.
Wie der Nobelpreis, sobald wir ihn aller Feierlichkeit entkleiden, auf der Entdeckung von Dynamit fußt, das wie andere menschliche Kopfgeburten – sei es die Spaltung der Atome, sei es die gleichfalls nobelierte Aufschlüsselung der Gene – das Wohl und das Wehe in die Welt gesetzt hat, so beweist die Literatur ihrerseits Sprengkraft, wenngleich die von ihr ausgelösten Explosionen verzögert, sozusagen in Zeitlupe zum Ereignis werden und die Welt verändern: gleichfalls als Wohltat und Anlaß zum Wehgeschrei für das Menschengeschlecht. Wieviel Zeit hat der Prozeß der europäischen Aufklärung von Montaigne über Voltaire, Diderot, Kant, Lessing und Lichtenberg benötigt, um die Funzel der Vernunft in die finstersten Winkel scholastischer Verdunkelung zu tragen. Oft genug wurde das Lichtlein gelöscht. Zensur verzögerte die Illuminierung durch Vernunft. Doch als sie sich dann in aller Helle breitgemacht hatte, war es eine erkaltete, aufs technisch Machbare reduzierte, einzig dem ökonomischen und sozialen Fortschritt verschriebene Vernunft, die sich als Aufklärung ausgab und ihren von Anbeginn zerstrittenen Kindern, dem Kapitalismus und dem Sozialismus, einen vernünftelnden Jargon und den jeweils richtigen Weg zum Fortschritt um jeden Preis eingebleut hatte.
Heute sehen wir, wohin es der Aufklärung genial mißratene Kinder gebracht haben. Wir können ermessen, in welch gefährliche Schieflage uns die durch Worte ausgelöste und zeitverschleppt wirkungsvolle Explosion geschleudert hat. Sicher, wir versuchen mit den Mitteln der Aufklärung – denn andere haben wir nicht – den Schaden zu beheben. Entsetzt sehen wir, daß der Kapitalismus, seitdem sein Bruder, der Sozialismus, für tot erklärt wurde, vom Größenwahn bewegt ist und sich ungehemmt auszutoben begonnen hat. Er wiederholt die Fehler seines totgesagten Bruders, indem er sich dogmatisiert, die freie Marktwirtschaft als einzige Wahrheit ausgibt, von seinen schier unbegrenzten Möglichkeiten berauscht ist und verrückt spielt, das heißt, weltweit Fusionen betreibt, die einzig den Profit maximieren. Kein Wunder, daß sich der Kapitalismus, wie der an sich selbst erstickte Kommunismus, als reformunfähig erweist. Globalisierung heißt sein Diktat. Und wieder einmal wird mit dem Dünkel der Unfehlbarkeit behauptet, dazu gäbe es keine Alternative.
Demnach ist die Geschichte zu Ende. Kein "Fortsetzung folgt ..." darf mit Spannung erwartet werden. Oder ist zu hoffen, daß, wenn schon nicht der Politik, die ohnehin jegliche Entscheidungskraft der Ökonomie überlassen hat, wenigstens der Literatur etwas einfällt, das den neuerlichen Dogmatismus ins Wanken bringt?
Wie aber könnte sich ein solch subversives Erzählen als Dynamit von literarischer Qualität erweisen? Wäre Zeit genug vorrätig, die Wirkung einer Spätzündung abzuwarten? Ließe sich ein Buch denken, dem die Mangelware Zukunft Auslauf böte? Ist es nicht gegenwärtig eher so, daß die Literatur aufs Altenteil verwiesen und den jungen Autoren allenfalls das Internet als Spielwiese eingeräumt wird? Betriebsamer Stillstand, dem das Schummelwort Kommunikation eine gewisse Aura verleiht, macht sich breit. Jeglicher Vorrat an Zeit ist bis zum menschenmöglichen Kollaps verplant. Ein kulturbetriebliches Jammertal nimmt die westliche Welt gefangen. Was tun?
In meiner Gottlosigkeit bleibt mir einzig übrig, das Knie vor jenem Heiligen zu beugen, der bislang noch immer hilfreich gewesen ist und die schwersten Brocken ins Rollen gebracht hat. Also flehe ich: Heiliger, von Camus' Gnaden nobelierter Sisyphos, bitte, sorge dafür, daß der Stein oben nicht liegen bleibt, daß wir ihn weiterhin wälzen dürfen, auf daß wir wie du glücklich mit unserem Stein sein können und die erzählte Geschichte von der Mühsal unserer Existenz kein Ende findet.
Ob wohl mein Stoßseufzer erhört wird? Oder sollte, nach neuestem Geraune, erst der gezüchtete Mensch als geklonte Schöpfung für die Fortsetzung der Humangeschichte zu sorgen befähigt sein?
Mithin bin ich wieder am Anfang meiner Rede und schlage noch einmal den Roman "Die Rättin" auf, in dessen fünftem Kapitel konjunktivisch die Verleihung des Nobelpreises an die Laborratte, stellvertretend für Millionen anderer Versuchstiere im Dienst der forschenden Wissenschaft, erwogen wird. Und sogleich wird mir deutlich, wie wenig bisher alle preisgekrönten Verdienste geeignet waren, die Geißel der Menschheit, den Hunger, aus der Welt zu schaffen. Zwar gelingt es, jeden, der zahlen kann, mit neuen Nieren zu versorgen. Herzen können verpflanzt werden. Drahtlos telefonieren wir rund um die Welt. Satelliten und Raumstationen umkreisen uns fürsorglich. Waffensysteme sind, infolge gepriesener Forschungsergebnisse, erdacht und verwirklicht worden, mit deren Hilfe sich ihre Besitzer vielfach zu Tode schützen können. Was alles des Menschen Kopf hergibt, hat seinen erstaunlichen Niederschlag gefunden. Nur dem Hunger ist nicht beizukommen. Er nimmt sogar zu. Wo Armut wie angestammt war, schlägt sie in Verelendung um. Weltweit sind Flüchtlingsströme unterwegs; Hunger begleitet sie. Und kein politischer Wille, gepaart mit wissenschaftlichem Können, ist entschlossen, dem wuchernden Elend ein Ende zu setzen.
1973, damals, als in Chile, gestützt auf das tätige Wohlwollen der USA, der Terror zuschlug, hielt als erster deutscher Bundeskanzler Willy Brandt seine Antrittsrede vor den Vereinten Nationen. Er kam auf die weltweite Verelendung zu sprechen. Sein Ausruf "Auch Hunger ist Krieg!" wirkte so überzeugend, daß ihn kurzerhand Beifall erschlug.
Ich war dabei, als diese Rede gehalten wurde. Zu jener Zeit schrieb ich an meinem Roman "Der Butt", in dem es um die primäre Grundlage menschlicher Existenz, um die Ernährung, also um Mangel und Überfluß, um große Fresser und ungezählte Hungerleider, um des Gaumens Freude und um die Brotrinden vom Tisch der Reichen geht. Dieses Thema ist uns geblieben. Dem sich anhäufenden Reichtum antwortet die Armut mit gesteigerten Zuwachsraten. Der reiche Norden und Westen mag sich noch so sicherheitssüchtig abschirmen und als Festung gegen den armen Süden behaupten wollen; die Flüchtlingsströme werden ihn dennoch erreichen, dem Andrang der Hungernden wird kein Riegel standhalten.
Davon wird in Zukunft zu erzählen sein. Schließlich muß unser aller Roman fortgesetzt werden. Und selbst wenn eines Tages nicht mehr geschrieben und gedruckt werden wird oder darf, wenn Bücher als Überlebensmittel nicht mehr zu haben sind, wird es Erzähler geben, die uns von Mund zu Ohr beatmen, indem sie die alten Geschichten aufs neue zu Fäden spinnen: laut und leise, hechelnd und verzögert, manchmal dem Lachen, manchmal dem Weinen nahe.
Weitere Informationen zum Literaturnobelpreis: http://www.nobel.se +++